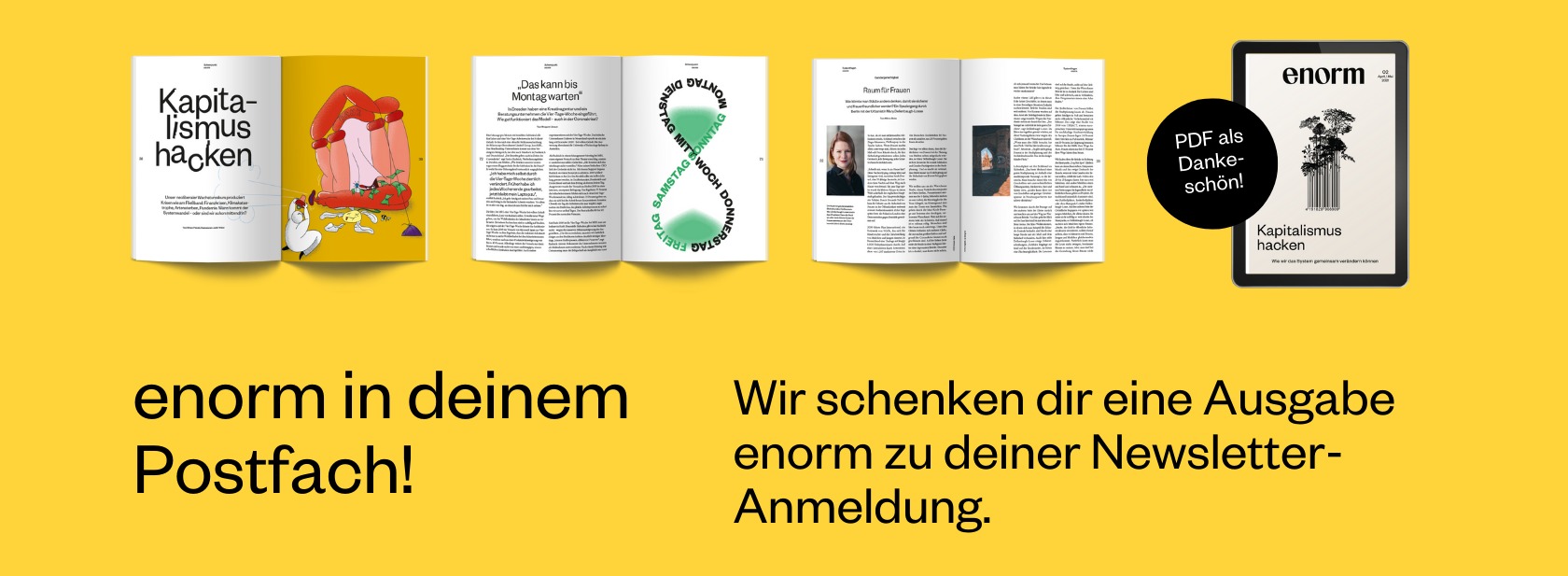Bioplastik
Das Kompost-Komplott
6 minuten
12 August 2014
)
Titelbild: Sri Lanka/Unsplash
Wertvoller Humus aus kompostiertem Plastik? Leider nur Wunschdenken, wie ein Blick auf die Bioplastik
6 minuten
12 August 2014
Falsches steht da nicht direkt. Es ist der Kreislauf der Elemente, den der Verbund kompostierbarer Produkte e.V. auf seiner Internetseite zeigt. Es geht um Erde, Humus, Wasser, Luft. Grüne Ranken und Biotonnen sind zu sehen, und Nährstoffe beschrieben, die der Dung an die Natur zurückgibt. Einzig überraschend ist, wer dahinter steht: Die Verbundsmitglieder sind alle aus der Plastikbranche. Chemieunternehmen wie BASF, die Granulat herstellen, Folienfabrikanten, die daraus Tüten gießen oder Gefrierbeutel machen. Das Bild, das sie und zunehmend andere Unternehmen zeichnen, ist verlockend: Plastik könne grün sein. Nutzbar ohne schlechtes Gewissen, weil es verrottet wie altes Laub.
Plastik ist nicht wegzudenken aus unserem Alltag. Wenn das Leben immer schneller wird und Wegwerfen praktischer als Wiederverwerten, gehören Einkaufstüten, Partybesteck und To-go-Verpackungen meist dazu. Ohne Einwegprodukte müssten wir die Geschwindigkeit drosseln und eingespieltes Verhalten ändern, ohne Folienverpackung den gesamten Konsum umstellen. Plastik kann auch Ressourcen sparen: Es ist ein robustes, leichtes Material, das lange lebt und sich spritsparend transportieren lässt. Doch es ist verpönt, spätestens seit Greenpeace es kilogrammweise aus den Mägen toter Meerestiere holt und Forscher an den Stränden der Erde kaum noch Sand finden, in dem keine Partikel davon sind – eben weil es so lange hält.
Ganz neuer Absatzmarkt
Bio-Plastik ist da wie eine Verheißung. Bio klingt nach Natur und das beschert den Herstellern Erfolg. Rund 604.000 Tonnen bioabbaubaren Kunststoff produzierte die Branche weltweit nach eigenen Angaben im Jahr 2012. Für Tüten, für Joghurtbecher, Kaffeekapseln, Computertastaturen, Turnschuhe oder Plastikflaschen. Fußballvereine wie Bayern München oder der VfL Wolfsburg schenken als CSR-Maßnahme in ihren Stadien Getränke hinein. Aldi und Rewe ließen ihre Kunden die Einkäufe darin einpacken. „100 Prozent kompostierbar“ oder „Zeig der Umwelt ein Lächeln“ schrieben sie auf die Tüten und verlangten 39 Cent dafür. Viel erhofft sich die Branche auch von den Folienbeuteln für Bioabfälle, einem ganz neuen Absatzmarkt.
Passend dazu schreibt der Verbund kompostierbarer Produkte auf seiner Internetseite: „Alles wie immer – nur besser.“ Niemand muss etwas ändern, sogar Produktionsmaschinen und -abläufe können gleich bleiben, es entstehen einfach nur keine unangenehmen Folgen. Zu erkennen für den Verbraucher sind die Produkte an einem aufgedruckten grünen Keimling, dem in Deutschland am weitesten verbreiteten Siegel für Kompostierbarkeit. Für die nächsten fünf Jahre erwartet die Branche ein Wachstum von 60 Prozent. Der Haken: In der Realität wird hierzulande aus Plastik kein Kompost. Oder, wie Hans Demanowski, Professor für Verpackungstechnik an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin, drastisch sagt: „Kompostierbares Plastik ist in den meisten Fällen kompletter Blödsinn.“ Woher solle ein Joghurtbecher wissen, ob er im Supermarkt steht oder auf dem Kompost liegt und ab wann er zerfallen darf? „Das ist reine Werbung.“ Zumindest ist es nicht so einfach, wie für den Verbraucher dargestellt.
Plastik kann aus fast allem hergestellt werden
Plastik ist eine Verkettung von Molekülen. Eng müssen sie miteinander verknüpft sein, damit das Material stabil ist. Damit Tüten nicht reißen und Becher nicht schmelzen. Hergestellt werden kann das aus so gut wie allem: aus Kohle und Erdöl, aus Mais, Soja, Büffelgras oder Orangenschalen. Und egal welche chemische Basis es hat, Plastik kann so zusammengebaut werden, dass es sich wieder in seine Bestandteile zerlegen lässt – oder für immer bleibt. Auch Kunststoff mit einem Maisanteil muss sich nicht notgedrungen auflösen. Auch herkömmliches erdölbasiertes Plastik kann „bioabbaubar“ sein.
Und dann ist es immer noch eine Frage des Aufwandes, wie lange es dauert, bis es sich abbaut. Theoretisch können Mikroorganismen eine sehr dünne bioabbaubare Folie in ein paar Wochen zersetzen – wenn die Bedingungen optimal sind. Wenn die Temperatur hoch und die Luft feucht sind und alles kontinuierlich durchmischt wird, so dass genug Sauerstoff rankommt. Jecker das Material, desto länger dauert der Prozess. Übrig bleiben am Ende, abgesehen von den Mikroben: CO2 und Wasser. So viel zur Theorie.
„Das ist total praxisfern“, sagt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Vor zwei Jahren fragte er mit seinen Kollegen stichprobenartig bei Betreibern von Kompostieranlagen nach, wie diese mit den als kompostierbar beworbenen Einkaufstüten von Aldi und Rewe umgehen. Nahezu alle von denen, die antworteten, gaben an, dass sie die Tüten aussortierten und zur Müllverbrennung brächten. Die Gründe: Die durchschnittliche Rottezeit in den Anlagen ist kürzer als für die Tüten nötig. Außerdem sei bioabbaubarer Kunststoff nicht von herkömmlichem zu unterscheiden.
Auch der Verband der Humus- und Erdenwirtschaft, in dem Dutzende Anlagenbetreiber organisiert sind, spricht sich dagegen aus, Plastik zu kompostieren. Dabei war Michael Schneider, der Geschäftsführer, am Anfang zumindest von den dünnen Beuteln für den Biomüll ganz begeistert. Als er sie zu Hause einführte, trennte seine Familie plötzlich viel lieber matschiges Obst oder feuchte Kartoffelschalen. „Nichts davon landete mehr in der Restmülltonne, genau das, was sich meine Kollegen von der Müllverwertung immer wünschen“, sagt er. Doch noch bevor seine erste Testrolle verbraucht war, hatten ihn die Anlagenbetreiber aufgeklärt: „Es gibt unzählige Kompostierverfahren in Deutschland, teilweise unter Luftabschluss, um Biogas zu gewinnen. Dafür sind die Beutel weder getestet noch geeignet“, sagt Schneider, „von Joghurtbechern, Plastikgabeln oder gar Tastaturen ganz zu schweigen.“ Auch gebe es schon jetzt, wo der Markt noch überschaubar sei, oft keine Klarheit über die Herkunft und Zusammensetzung der verwendeten Folien. In den Anlagen aber bestehe im Alltagsgeschäft keine Chance, zu erkennen, woraus die einzelnen Kunststoffe wirklich sind. „Meine Kollegen verzichten lieber auf das Mehr an Bioabfällen, als dass sie in Kauf nehmen, Plastikreste im Endprodukt zu haben.“
Auch Bertram Kehres sieht das so. Er ist Geschäftsführer der Bundesgütegemeinschaft Kompost und zuständig dafür, die Qualität des Produktes zu sichern, das am Ende bei den Kompostieranlagen herauskommt – denn es landet häufig als Dünger auf dem Feld. Selbst wenn das Kompostieren des Plastiks funktionieren würde, sagt er, ergebe es keinen wertvollen Humus, sondern im besten Falle nichts. Keine Nährstoffe, keine Spurenelemente gebe das Material frei, nur Energie, die ungenutzt bleibt. In einem Positionspapier empfiehlt Kehres die energetische Verwertung: Wenn man Plastik mit dem Restmüll verbrennt, wird dabei zumindest noch ein bisschen Energie gewonnen.
Kein Vorteil für die Umwelt?
Eine Studie des Umweltbundesamtes von 2012 ergab, dass in der gesamtökologischen Betrachtung biologisch abbaubare Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen gegenüber denen aus fossilem Rohöl keinen Vorteil für die Umwelt haben. Ein Grund: Für herkömmliche Stoffe gibt es Verwertungskreisläufe. Aus recycelten PET-Flaschen können zum Beispiel Fleece-Jacken oder Kugelschreiber werden. Bioabbaubares Plastik aber will auch bei den Kunststoffrecyclern keiner. Die Sorge ist die selbe wie beim Kompost: Es könne das Endprodukt verunreinigen.
Bleibt die Frage, warum auf Artikeln, die nicht kompostiert werden, „kompostierbar“ draufstehen darf. Warum, wenn das, was in die Biotonne darf, schon in Deutschland in jeder Kommune anderen Regeln folgt, es ein Siegel geben kann, das nicht nur hierzulande, sondern europaweit auf Verpackungen prangt.
Die Antwort zeigt, wie geschickt verschiedene Wirtschaftsorgane ineinandergreifen und so Glaubwürdigkeit erzeugen. Erst einmal aber ist sie ganz einfach: Jeder Hersteller darf alles auf seine Verpackung schreiben, solange es keine falsche Tatsachenbehauptung ist. Und theoretisch sind die Stoffe ja kompostierbar.
Die Kriterien des Siegels besagen, dass Bioplastik unter industriellen Bedingungen nach drei Monaten zu 90 Prozent verrottet sein muss. Die Rottezeiten der Kompostieranlagen dagegen liegen meist zwischen vierund acht Wochen – je nachdem, welche Qualität der Kompost am Ende haben soll. Jeder Tag kostet extra. Das lohnt sich bei Küchenabfällen oder Laub meist nicht.
Das Siegel mit dem Keimling ist eine Marke von European Bioplastics. Wer es auf sein Produkt drucken möchte, sucht und bezahlt ein Labor, das testet, ob die nötigen Vorgaben erfüllt sind. Zertifizierungsunternehmen überprüfen die Ergebnisse schließlich und vergeben das Siegel. „Herstellerunabhängig“ heißt dieses Verfahren. Das ist rechtlich völlig in Ordnung, auch wenn alle Beteiligten daran verdienen. Auf die Frage, warum die Kriterien bei der Zertifizierung nicht an die Gegebenheiten in den Kompostieranlagen angepasst werden, heißt es bei Bioplastics: Das Keimlingssiegel beziehe sich auf die EUNorm für Kompostierbarkeit und sei abgesehen davon bereits etabliert. Eine Änderung würde den Verbraucher verunsichern.
Genormt klingt gut
EU-Norm klingt schön offiziell. Auch andere Kompostsiegel für Bioplastik beziehen sich darauf, „OK Compost“ etwa oder „DIN geprüft industriell kompostierbar“. Genauer ist es die Norm DIN EN 13432 – erdacht zu einem großen Teil von Vertretern der Plastikbranche. Wie alle Normen ist sie privatwirtschaftlich initiiert und verwaltet vom Verein Deutsche DIN. Wer genau die 38 Personen waren, die in den 90er-Jahren die Kriterien zur Kompostierbarkeit in Europa festlegten, ist auf Wunsch der Beteiligten geheim. Bekannt ist lediglich, dass das Gremium weitestgehend aus Mitarbeitern von Bioplastikproduzenten, Zulieferern und Forschungseinrichtungen bestand.
Anfangs war auch ein Kollege von Bertram Kehres von der Bundesgütegemeinschaft Kompost mit dabei. „Wir dachten, es geht nur um die dünnen Plastikbeutel für den Biomüll und wollten sicherstellen, dass die Prüfverfahren vernünftig sind“, sagt Kehres. „Aber der Wunsch der Industrie war es, Kriterien zu schaffen, die für sämtliche andere Verpackungen bis hin zu Kinderspielzeug und Turnschuhen ausreichen. So eine Vielfalt an Stoffen, die nichts mit Kompost zu tun haben, das war der totale Graus für uns.“ 2010 trat die Gütegemeinschaft aus dem Gremium aus.
Im Frühjahr 2012 dann veröffentlichte die Deutsche Umwelthilfe zwei Pressemitteilungen, die darüber informierten, dass die Aldi- und Rewe-Tüten in Deutschland nicht kompostiert würden. Die Discounter nahmen die Tüten daraufhin aus dem Sortiment. Der Hersteller verklagte die Umwelthilfe in Millionenhöhe – und verlor. Auch vereinzelte Fabrikanten von Plastiksäcken für Küchenabfälle reagierten, allerdings fragwürdig. Zum Kompostsiegel drucken sie jetzt den Hinweis, dass die Beutel in einigen Kommunen nicht in die Biotonne geworfen werden dürfen. In diesem Fall solle der Verbraucher auf Papiertüten zurückgreifen – oder die Folienbeutel im Hauskompost entsorgen. Wie lange sie dort liegenbleiben, steht nicht dabei.