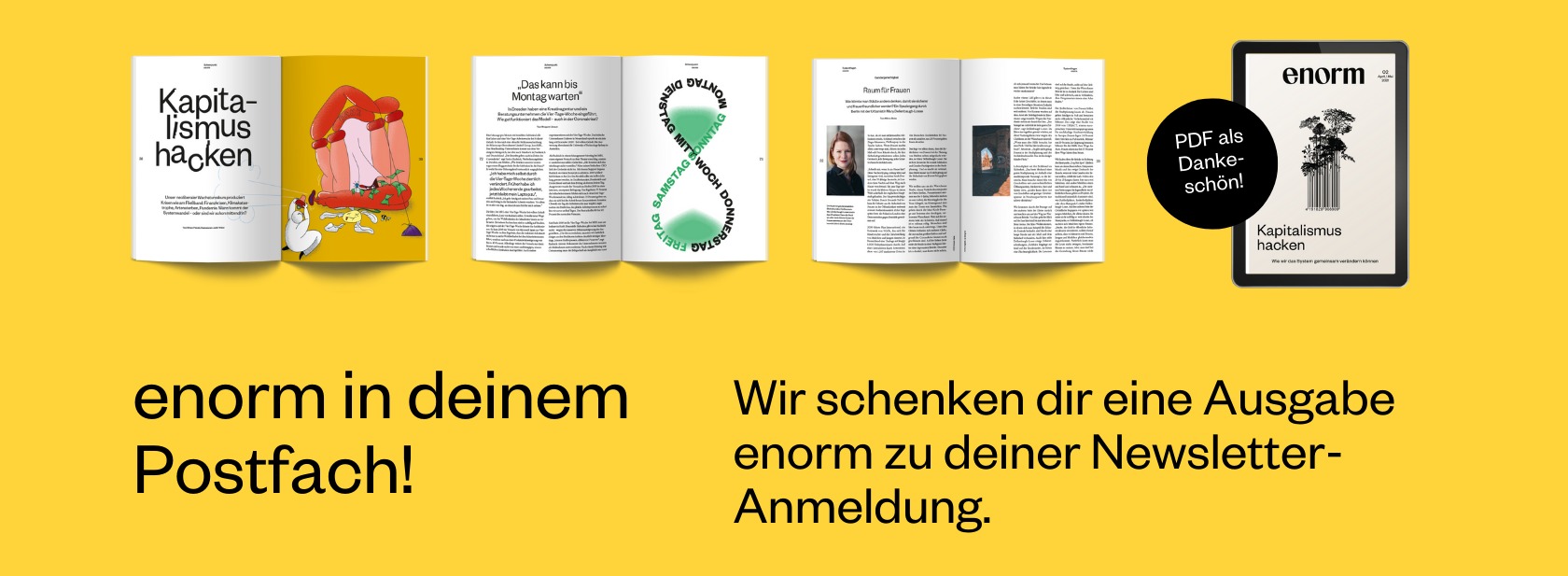Übernahme beim Kartoffelkombinat gescheitert
Der Gärtner will nicht
3 minuten
6 November 2014
)
Titelbild: Kartoffelkombinat/Florian Generotzky
Das Kartoffelkombinat ist auf der Suche nach einer neuen Anbaufläche
3 minuten
6 November 2014
Es ist ein Wachstum, mit dem so manches Unternehmen überfordert wäre. Innerhalb von zweieinhalb Jahren hat sich das Münchner „Kartoffelkombinat“ von einer fixen Idee der Gründer Simon Scholl und Daniel Überall in eine Gemüseversorgung für fast 550 Familien entwickelt. Scholl und Überall wollten nicht mehr nur über verantwortungsvolle Ernährung reden, sondern sich mit selbst erzeugten, regionalen Lebensmitteln versorgen. Sie gründeten eine Genossenschaft, deren Ziel es ist, zusammen mit Gleichgesinnten eine Bio-Gemüsegärtnerei „freundlich“ zu übernehmen. Auf diese Weise wollen die Mitglieder des Kartoffelkombinats unabhängig von Industriestrukturen werden und selbst bestimmen, was angebaut wird und wie das geschehen soll: nämlich fair, regional und biologisch. Die solidarische Landwirtschaft (Solawi) wird in Deutschland immer beliebter; rund 40 gibt es inzwischen deutschlandweit, Tendenz steigend. Das Kartoffelkombinat ist inzwischen die mitgliederstärkste.
Möglich wurde dies, weil die beiden Münchner mit der Naturlandgärtnerei von Sigi Klein einen mutigen Partner für das Experiment fanden. Andere Solawis sammeln oft erst ausreichend Mitglieder und gründen dann einen Landwirtschaftsbetrieb. Die Partnerschaft mit der Naturlandgärtnerei ermöglichte es dem Kartoffelkombinat, sofort Gemüse zu beziehen. Gemeinsam wollten sie das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft testen.
Gemeinsam entscheiden, was wie angebaut wird
Und das funktioniert so: Mit Eintritt in das Kartoffelkombinat und einer einmaligen Kapitalbeteiligung in Höhe von 150 Euro werden die Mitglieder zugleich Eigentümer und Kunden der Genossenschaft. „Am Kartoffelkombinat teilnehmende Haushalte sind nicht mehr nur reine Konsumenten von Lebensmitteln, sondern sie organisieren Schritt für Schritt selbst ihr eigenes Bio-Gemüse“, sagt Überall. Wöchentlich erhalten alle Mitglieder eine Kiste mit diesem Gemüse geliefert. Das kostet pro Monat 68 Euro.
Der Unterschied zu einer Ökokiste? Alle Mitglieder sind Teil dieser Unternehmung; sie entscheiden gemeinsam darüber, was angebaut wird. Anders als in der freien Wirtschaft wird der Gärtner durch die Genossenschaftsbeiträge vorfinanziert. Der Monatsbeitrag fließt in den Anbau des Biogemüses, die faire Bezahlung der Gärtner, die Pacht und die Logistik. „Wir nehmen Lebensmitteln ihren Preis und geben ihnen ihren wahren Wert wieder“, sagt Simon Scholl. „Jede Karotte, jede Tomate, jede Gurke ist keine Ware, sondern das Ergebnis eines gemeinschaftlichen Engagements.“
Und die Gemeinschaft trägt auch das Risiko des Erzeugers mit. Sollten einmal Käfer über einen Teil der Ernte herfallen, ist die Kiste eben weniger voll. Das Miteinander ist erwünscht: Wer will, kann helfen, Setzlinge auszupflanzen, bei der Ernte mitarbeiten oder übrig gebliebene Tomaten zu Sugo einkochen. In einer eigens gegründeten „Kartoffelakademie“ tragen Mitglieder oder Gastredner ihr Wissen weiter. Das klingt schön, ist aber auch viel Arbeit. Gründer Simon Scholl ist mit Logistik- und Kistenplanung gut und gerne 60 Stunden in der Woche beschäftigt, Daniel Überall kümmert sich um Kommunikation nach außen und innen: bei nahezu 1000 Menschen eine zeitaufwendige Aufgabe. Nur die Akquise geht praktisch von allein. Denn die begeisterten Mitglieder werben immer neue Genossen allein durch Mundpropaganda, so Daniel Überall.
Die Gärtnerei will doch nicht übernommen werden
Diesen Herbst nun stand der erste große Meilenstein an: Die tatsächliche Übernahme der Naturlandgärtnerei, die seit Gründung der Genossenschaft vor zweieinhalb Jahren über das Jahr betrachtet, rund die Hälfte des Gemüses an die Genossen liefert. Doch statt zu feiern, müssen Scholl und Überall zum ersten Mal mit einem wirklichen Rückschlag klarkommen.
Die Räume der Gärtnerei Klein werden vom Kartoffelkombinat genutzt, von einer Mitgärtnergruppe und auch privat von der Familie des Gärtners. „Die Gärtnerei ist ein sehr lebendiger Ort, das gefällt mir“, sagt Klein. Aber wie das oft ist bei gemeinschaftlicher Nutzung, kommt es auch zu Konflikten und Missverständnissen. „Der Betrieb ist mein Lebenswerk, den ich in 29 Jahren selbst aufgebaut habe – da will ich mir einfach nicht reinreden lassen, “ sagt Klein, der selbst auch Genosse des Kartoffelkombinats ist. Der 58-Jährige hatte auf eine langsame Übergabe seines Betriebs gehofft, will aber die Souveränität noch nicht vollständig abgeben. Lieber wollte er das Kartoffelkombinat langfristig als Kunden an sich binden. „Das widerspricht aber fundamental unserem Ziel – wir wollen ja kein normaler Gemüsehändler sein, sondern selber über alle Abläufe bestimmen“, sagt Überall. Nach längeren Gesprächen – wobei sogar ein Wirtschaftsmediator zum Einsatz kam – teilte Sigi Klein den Genossen mit, er wolle keine langfristigen Verpachtung oder Verkauf. Die Verhandlungen waren gescheitert.
Der Schnitt ist hart, es klingen verletzte Gefühle auf beiden Seiten durch. „Klar, ist das für mich schwierig“, sagt Sigi Klein. „Ich habe viele der Menschen, die sich hier engagiert haben, liebgewonnen – und habe schon auch das Gefühl, sie vor den Kopf zu stoßen.“ Ähnlich äußert sich das Kartoffelkombinat. „Natürlich sind wir enttäuscht“, sagt auch Überall. „Es war viel Arbeit, die Verbindung der Haushalte mit der Gärtnerei herzustellen. Seht her, das ist eure Ernte, aus eurer Erde. Jetzt muss sich diese emotionale Bindung wieder lösen.“
Aber man habe in diesem Jahr „extrem viel gelernt“ und in der Zwischenzeit eine große und starke Genossenschaft aufgebaut, meint Überall. Damit hat das Kartoffelkombinat inzwischen auch mehr Möglichkeiten als noch vor zwei Jahren. Die Versorgung ist weiter über Partnerbetriebe gesichert, doch nun sind sie wieder auf der Suche. Ist erst ein geeigneter Betrieb gefunden, den sein Besitzer abgeben will, wird es keine lange Eingewöhnungszeit mehr geben. Diesmal gilt: am liebsten gleich kaufen.