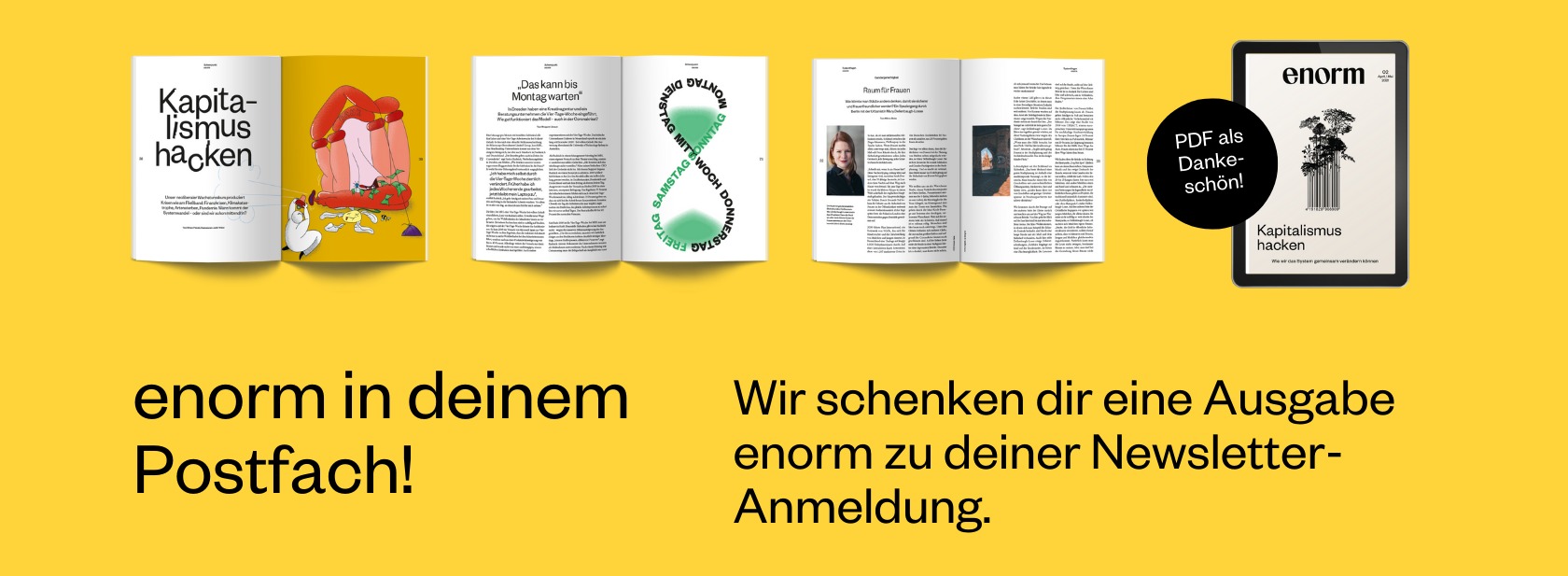Interview zum ökosozialen Wandel
„Wir wollen keine Ausbeuter sein“
5 minuten
17 July 2017
)
Für Luise Tremel ist der Atomausstieg ein Beispiel dafür, wie eine echte Transformation aussehen kann. Aber auch dafür, welche Probleme es dabei gibt
5 minuten
17 July 2017
Frau Tremel, Sie sind Wissenschaftlerin, Redakteurin und beraten Unternehmen. Wie geht all das zusammen?
Bei allen Tätigkeiten geht es in dieselbe Richtung: Wie kann man verantwortungsvoll die Gesellschaft prägen durch das, was man tut? Allein bei der Stiftung Futurzwei, bei der ich arbeite, habe ich ungefähr 400 transformative Modelle betrachtet, immer unter den Fragen: Was ist wünschenswert? Wo scheitern die Projekte? Mich reizt es zu analysieren, wie wir etwas bauen können, das den dringend nötigen ökosozialen Wandel trägt. Wir müssen herausfinden: Wie funktioniert Wandel realistisch? Was muss passieren, damit eine Gesellschaft mit etwas aufhört, das nicht zukunftsfähig ist?
Darüber promovieren Sie und vergleichen die heute nötige Transformation mit der Geschichte der Sklaverei. Warum ausgerechnet Menschenhandel?
Ich habe auch überlegt, ob der Verzicht auf Getränkedosen oder das Aufhören mit dem Rauchen geeignet wäre. Aber nur die Sklaverei ist von der Größenordnung einigermaßen vergleichbar. Anhand dieses Abschaffungsprozesses lässt sich abstrahiert gut beschreiben, was zu erwarten ist, wenn man von etwas lassen will, woran sich eine Gesellschaft schon lange gewöhnt hat – wie eben unsere fossile Wirtschaftsordnung.
Welche Parallelen gibt es zwischen der Sklaverei und unserem Ressourcenverbrauch?
Zwei Punkte sind entscheidend: Ausbeutung und Selbstdeprivilegierung. Beginnen wir mit ersterem: Heute steht außer Frage, dass es Ausbeutung ist, einen anderen Menschen als Sklaven zu halten. Gleichzeitig nutzen wir die Ressourcen der Welt und auch andere Menschen aus. Wie bei der Sklaverei werden in ein paar Generationen die Menschen hoffentlich auf unseren Konsum zurückschauen und sagen: „Das war eine Art Ausbeutung, und die musste beendet werden.“
Wo sind strukturelle Parallelen?
Ausbeutung hat mit Auslagerung zu tun, also mit der Externalisierung von Kosten. Die Ausbeutung besteht heute darin, dass wir durch unseren Konsum andere Personen als billige Arbeitskräfte ausnutzen und gleichzeitig ihre natürliche Lebensgrundlage konsumieren, indem wir den wahren Preis für unseren Ressourcenverbrauch nicht zahlen. Ähnlich war das früher, rund um den Atlantik, wo Produkte dadurch günstig sein konnten, dass sie von Sklaven angebaut wurden. Die Kosten sind bei den Verbrauchern nicht angefallen – sie wurden ausgelagert.
Luise Tremel
ist Doktorandin im Transformationskolleg der Europa-Universität Flensburg, wo seit Herbst 2017 der Master-Studiengang Transformationsstudien angeboten wird. Ihr Doktorvater ist der Soziologe Harald Welzer. Zudem leitet die Berlinerin bei der Stiftung Futurzwei das internationale Projekt „Future Perfect“, das Geschichten des ökosozialen Gelingens aus mehr als 30 Ländern eine Plattform bietetUnd was ist mit Selbstdeprivilegierung gemeint?
Wir als Profiteure des bestehenden Systems müssen sagen: „Wir geben diese Privilegien freiwillig ab, weil wir nicht mehr weiter Ausbeuter sein wollen.“ Es gibt in der Geschichte aber – abgesehen von der Abschaffung der Sklaverei – kaum gute Beispiele von Gesellschaften, die sich entscheiden, kollektiv ihre eigene Privilegien abzugeben.
Wie soll das dann gelingen?
Dieser Schritt ist nur durch besseres Wissen zu schaffen – und durch Zwang. Es ist wie früher: Die weißen Profiteure der Sklaverei haben sich selbst zu einem Ende ihrer Privilegien verpflichtet, und dazu brauchte es einen Bewusstseinswandel und Regulierung.
Und viel Zeit.
Ja, der gesamte Befreiungsprozess dauerte international zwischen 60 und 100 Jahren, und in vielen gesellschaftlichen Strukturen wirkt die Sklaverei bis heute nach. Unsere heutigen Gesellschaften müssen diesen Wandel schneller schaffen und sind bereits einige Schritte gegangen. Trotzdem ist es wichtig, ein Verständnis davon zu haben, was in einer Transformation passiert. Die kann Jahrzehnte dauern und immer auch wieder abbrechen. Erschwerend kommt hinzu, dass wir es mit einem internationalen Problem zu tun haben, damals wie heute.
Sie sagen, der Prozess des Aufhörens durchläuft fünf Phasen. Welche?
Jeder Prozess muss erst Fahrt aufnehmen. Da sehe ich zwei Phasen, die lange dauern und eng zusammenhängen: Problematisierung und Mobilisierung. Hier wird das Problem verstanden und eine entsprechende Bewegung aufgebaut – da sind wir in puncto Umwelt gar nicht so schlecht. Um dieses Wollen aber allgemeingültig zu machen, braucht es in der dritten Phase Regeln und Gesetze, also zum Beispiel Verbote. Dieser Regulierung folgt dann die Neuordnung, zunächst mit einer chaotischen Phase, in der sich alle Betroffenen sortieren müssen, ich nenne das Ad-hoc-Neuordnung. Diese wiederum mündet in die finale Phase der Konsolidierung.
Welche Phase ist die wichtigste?
Alle sind wichtig. Aber ich bin mittlerweile überzeugt, dass Aufhören ohne Regulierung nicht geht. Es ist zu wenig, wenn alle denken, jetzt kommen Innovationen wie E-Autos und Windräder, und dann wird alles gut. Ich glaube, ein Großteil der ökologischen Bewegung denkt überhaupt nicht daran, dass auch die Abkehr von den umweltzerstörenden Technologien und Infrastrukturen politisch umgesetzt werden muss – als Verbote oder Beschränkungen.
Taugt die Atomkraft als Beispiel für eine solche Regulation?
Ja, aber nur bedingt, weil wir uns lediglich von einer einzigen schädlichen Energiequelle trennen, also eigentlich kaum Einschnitte zu spüren sind. Aber vieles entspricht meinem Modell: Wir hatten beim Atomausstieg eine lange Phase des Problematisierens und Mobilisierens. Dann passiert Fukushima, und plötzlich kommt es ganz schnell zur Regulierung. Das passiert aber nicht allein, weil die Mobilisierungsphase so erfolgreich gewesen wäre, sondern aufgrund eines externen Ereignisses.
Ohne Mobilisierung vorab wäre die Regulierung nicht gekommen?
Nein, für eine fundamentale Veränderung von Denken und Handeln braucht es beides: Es muss ziemlich viel Holz zusammengetragen worden sein, damit es auch brennt, wenn ein Funke wie Fukushima kommt. Dann passiert aber etwas, was so typisch ist wie gefährlich: Die Aktivisten, die jahrzehntelang auf der Straße waren, wirken nicht mehr wichtig. Jetzt ist nämlich die Politik zuständig und verhandelt mit den Atomkonzernen. Organisationen wie Campact versuchen, ein „Wir bleiben dran“-Gefühl zu erzeugen – mit geringem Erfolg. Dabei wäre das gerade wichtig, um in dieser Ad-hoc-Phase nicht den Energiekonzernen und der Verwaltung das Feld zu überlassen – und damit die Verhandlungen darüber, was als Nächstes passiert.
Es gibt bei der Transformation verschiedene Themen: unseren Konsum, die Mobilität, die Arbeitswelt und viele mehr. Sollte man die isoliert betrachten?
Auf keinen Fall. Wenn wir unseren Ressourcenverbrauch strategisch verändern wollen, sollten wir die Themen nicht einzeln sehen, sonst werden die verschiedenen Prozesse einander torpedieren. Die sind ja miteinander verbunden. Vielmehr müssen wir offen diskutieren, welche Privilegien wir behalten und welche wir abgeben wollen: Wie viel Fliegen, neue Klamotten, Fleisch essen können wir uns erlauben?
Das klingt unmöglich.
Natürlich überfordert das unsere Gesellschaft total. Trotzdem glaube ich, dass es keine Alternative gibt.
Glauben Sie, dass eine sogenannte Öko-Diktatur helfen würde?
Keine Ahnung. Aber sie würde neue Probleme erzeugen. Ich wünsche mir, dass die Transformation demokratisch bewältigt wird. Die Sklaverei habe ich auch deswegen untersucht, weil es demokratische Gesellschaften waren, die sie abgeschafft haben. Jedes Szenario, in dem wir uns nicht aus freien Stücken aus dieser Ausbeutung befreien, wird extrem unangenehm – und einen freiwilligen Wandel kriegen wir nur hin, wenn wir uns jetzt einschränken.
Kaum realistisch. Bei dem Vorstoß der Grünen für einen Veggie-Day haben wir gesehen, was passieren kann, wenn man Einschränkungen fordert.
Der Veggie-Day mit seinem vergleichsweise harmlosen Regulierungsansatz wurde komplett abgewatscht. Mit der Folge, dass die Grünen nun vor jeglichen Verboten zurückschrecken. Das ist ziemlich schlecht gelaufen. Diese Art von Rückschlag ist leider typisch für Abschaffungen. Trotzdem: Wenn man etwas abschaffen will, braucht es Regulierung – gern auch kombiniert mit Anreizen.
Könnte die EU unterstützen?
Ich möchte nicht für die schlechte Laune zuständig sein, aber der Zustand der EU ist ein Problem für die ökosoziale Transformation. Denn die bräuchte eine einigermaßen einheitliche Bewegung in eine klare Richtung, und das ist aufgrund der Unterschiedlichkeit der Staaten und der Entscheidungsstrukturen zurzeit total unwahrscheinlich. Ich sehe nicht, dass sich Ungarn, Polen oder Frankreichs Nationalisten für Einschnitte begeistern ließen.
Dabei ergrünt der Konsum doch.
Aber nicht auf breiter Front, das ist eine falsche Wahrnehmung. Wirklich interessant wird es erst, wenn das Ökosoziale im Mainstream ankommt. Das ist etwas völlig anderes als eine Nische, mit ganz eigenen Logiken. Das zeigt auch der Sklaverei-Prozess. Wenn etwas aus der Nische mehrheitsfähig wird, werden die Pioniere oft sogar herausgeschmissen aus ihrem Projekt, weil man sie im Mainstream nicht mehr braucht oder die Idealisten finden, dass man sich gemein macht mit dem Gegner.
Aber wir sehen ja auch einen Wandel innerhalb großer Unternehmen.
Zarte erste Pflänzchen, ja, aber da geht noch viel mehr. Dafür müssen dann die Anreize anders gesetzt sein: Wenn Angestellte nicht mehr für mehr Gewinn belohnt würden, sondern für etwas, das in eine transformative Richtung weist, dann würde sich einiges bewegen. Damit müssten wir aber ernsthaft aus der jetzigen Wirtschaftslogik aussteigen. Es passiert noch ziemlich wenig. Aber etwas muss passieren.