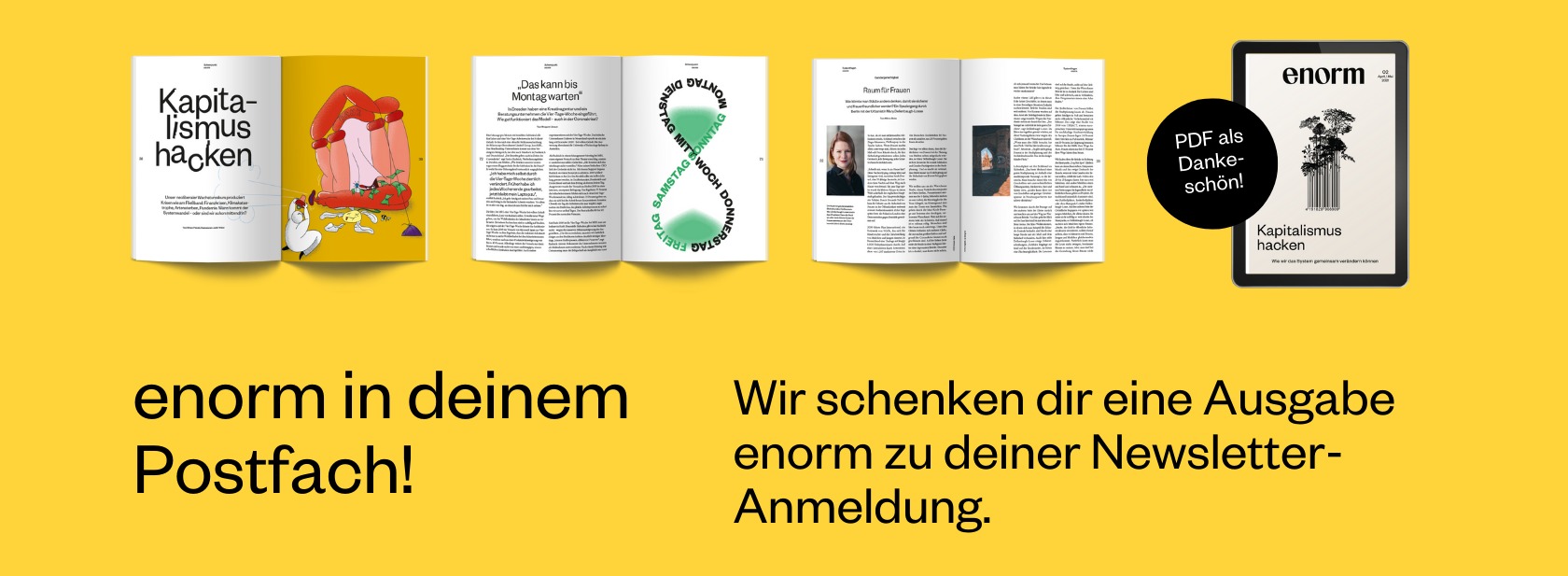Demokratie
Es ist Zeit für Mut und Aufbruch
9 minuten
23 October 2017
)
Titelbild: Max Slobodda
Eine Rundreise durch die neue Parteien-Bewegung
9 minuten
23 October 2017
Im Januar 2017 hat Alexander Plitsch endgültig genug: Stopp. Ich muss etwas tun. Jahrelang hatte der Chef einer Aachener Kommunikationsagentur beobachtet, wie sich Parteien im Wahlkampf gegenseitig zerfleischen. Hatte bei eigenen Ausflügen in die Lokalpolitik erlebt, wie fern diese Welt seiner dynamischen, schnellen Realität als junger Unternehmer ist. Bezirksrunden in verstaubten Gaststätten, zermürbende Endlosdebatten über Ampelschaltungen und Zebrastreifen. Stadtteilwahlkampf vor dem Kiez-Supermarkt, fertig konfektionierte Lösungen für Rente, Arbeitslosigkeit und Bildungsmisere gelangweilt unterm Sonnenschirm präsentiert.
Wer, fragte sich der 33-jährige, soll sich da angesprochen fühlen? Nicht, dass sich die Jüngeren nicht engagieren wollen. Doch sie sehnen sich nach lebendigen Debatten über Grundsatzfragen: Klimawandel, Tierschutz, Chancengleichheit; nach gezieltem, zeitlich begrenztem Engagement, das sich mit dem vollgepackten Alltag zwischen Kind und Job vereinbaren lässt. Als 2016 die rechten Bewegungen in Europa an Fahrt aufnehmen, steht für Plitsch fest: Wir müssen die Demokratie neu beleben, damit alle gemeinsam wieder für sie eintreten. Jetzt. Im April 2017 gründet er mit einer Gruppe von Mitstreitern „Demokratie in Bewegung“.
Es klingelt, Plitsch schnappt den Hörer. Dieser Tage steht das Telefon nicht still, Pressetermine überschlagen sich, die Mailbox quillt über. Gerade erst hat der Bundeswahlleiter die neue Partei durchgewunken. Demokratie in Bewegung (DiB) durfte bei der Bundestagswahl im September antreten. In acht Landeslisten ist sie bereits aufgestellt, hat 250 Mitglieder, 80 Prozent von ihnen sind zum ersten Mal in einer Partei.
Die Ideen des Newcomers überzeugen: Jeder kann hier online Themen zur Debatte einreichen, über 100 werden gerade parallel diskutiert und im Netz abgestimmt. Es gibt keinen Fraktionszwang, sondern Mehrheitsentscheidungen, keine strengen Hierarchien, sondern Themenkreise, Ämter sind auf acht Jahre beschränkt. Statt dem Bürger fertige Ideen zu servieren, lädt DiB zu offenen Debattenrunden. Viele Ideen sind noch in der Entwicklungsphase: ein legislativer Fußabdruck, der mit einem Klick auf jeden Absatz in Gesetzestexten den Einfluss von Interessengruppen zeigt; Video-Debatten, die auch Nichtmitgliedern offen stehen; Facebook-Gruppen, die Gehörlose ansprechen. DiB ist Partei mit Startup-Feeling, ein dynamisches Experimentierfeld für die Demokratie 2.0. Trial and Error, Hauptsache loslaufen und machen. Das Ziel: „Wir wollen zur Blaupause einer anderen Demokratie werden.“
Hohe Ansprüche, niedrige Bindungskraft
Demokratie neu denken, mitmischen, etwas tun – es ist Bewegung in die Republik gekommen. Bürger schließen sich zusammen, um ihrem Willen Ausdruck zu geben und das Land mitzugestalten. Sie gehen mit Initiativen auf die Straße, um ihr Anliegen sichtbar zu machen. Sie versuchen die etablierten Parteien von Innen zu verändern, plädieren für einen modernen Konservativismus (CDU) oder eine Erneuerung des Liberalismus (FDP). Oder sie gründen neue Parteien, wie DiB, das Bündnis Grundeinkommen oder die Jugend- und Entwicklungspartei Deutschlands. 34 Parteien traten am 24. September zur Bundestagswahl an, vier mehr als vor vier Jahren. Die neue demokratische Bewegung hat alle westlichen Industrieländer erfasst. Aufgerüttelt durch den Brexit, die Wahl Donald Trumps und den Aufstieg der Rechtspopulisten in Europa eint sie das Gefühl: Es ist Zeit, sich zu organisieren und für die Demokratie zu kämpfen.
Denn es ist spürbar: Die Demokratie gerät in Bedrängnis. Viele Menschen sehen ihre Interessen nicht mehr ausreichend von den etablierten Parteien vertreten. Die großen Organisationen erscheinen ihnen eher wie geschlossene Kartelle der Macht, denn als adäquate Repräsentation der Bürger, unfähig die drängenden Probleme der Gesellschaft zu lösen von der Europapolitik bis zur Flüchtlingskrise. Von „mangelnder Responsivität“ und einer „gravierenden Repräsentationslücke“ spricht der Parteienforscher Bernhard Weßels vom Wissenschaftszentrum Berlin. „Wo eine wachsende Zahl von Bürgern die Politik als ohnmächtig erlebt, können neue Gruppierungen wie die AfD punkten“, so Weßels. „Denn sie besetzen Themen, die sonst niemand aufgreift.“
Alle Glieder der Gesellschaft angemessen zu repräsentieren, wird nach Weßels‘ Einschätzung dabei zunehmend schwieriger. „Auf der einen Seite ist die Gesellschaft komplexer geworden, Interessensgruppen differenzieren sich aus, und durch die Bildungsrevolution der vergangenen 30 Jahre sind die Ansprüche der Bürger an die Politik gestiegen“, beobachtet er. „Auf der anderen Seite nähern sich Parteien inhaltlich an, sie bieten weniger statt mehr Differenz.“ Die Folge: Die Bindungskraft der etablierten Parteien nimmt ab, die Zahl der Wechselwähler zu. Bei 10 Prozent lag ihr Anteil in den 80er Jahren, heute sind es fast 40 Prozent. „Ein fluides Stimmungsmilieu ist entstanden“, schlussfolgert der Münchener Demokratieforscher Werner Weidenfeld, „das den Raum für neue Parteibildungen öffnet“.
Parteigründung im Abistress
Lukas Ostermann war selbst erstaunt, wie einfach das geht: eine Partei gründen. Auch er fühlte sich von den Etablierten nicht repräsentiert, als er kurz vor dem 18. Geburtstag mit seinem Freund Till Müller durch die Parteiprogramme stöberte. Egal ob in Punkto Bildungspolitik oder Generationenvertrag – die Anliegen Jugendlicher? Fehlanzeige. „Komm, wir machen es selbst“, witzelte Müller. Ostermann schlug ein. Mitten im Abistress gründete das Duo die Jugend- und Entwicklungspartei Deutschlands (JED). „Wir waren schon immer Macher.“ Devise: Nicht meckern, tun. Die Themen: generationengerechte Renten, bessere Bildung, mehr Europa.
Wie wichtig Politik ist, hatte Ostermann schon zu Hause gelernt. Die Mutter aus Griechenland, der Vater selbstständig, Debatten über Europa und Wirtschaftspolitik gehörten zum Alltag, Anpacken war Pflicht. Ostermann engagierte sich in der Schülervertretung, erstritt Lockerungen des Handyverbots in seinem Gymnasium. Das Netzwerk an der Schule hat ihm später geholfen, die ersten Mitglieder für die JED zu gewinnen. Für drei Euro im Monat vertreten werden von Gleichaltrigen, das zog genauso wie die Ansprache via Facebook und WhatsApp: Sagt uns, welche Themen euch noch wichtig sind.
Mühsamer war das Unterschriftensammeln in der Fußgängerzone von Rheine, 1000 braucht es, um bei einer Landtagswahl antreten zu dürfen. Das hieß Sprüche aushalten wie: „Geht erst mal arbeiten, ihr habt doch keine Ahnung vom Leben“. Das hieß aber auch ermutigt werden: „Toll, dass ihr euch engagiert.“ Der Einsatz hat sich gelohnt. Die JED trat bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an und bekam aus dem Stand 7054 Stimmen, 0,1 Prozent. Die Zulassung zur Bundestagswahl hat trotzdem noch nicht geklappt, noch mal 2000 Unterschriften waren zu viel. „Macht nichts“, sagt Ostermann. „Der Orgaplan für die Europawahl 2019 steht schon.“
Ob aus einer Initiative oder Bewegung eine Partei wird, hängt von vielen Faktoren ab. Trifft sie den Nerv der Zeit? Stößt sie in eine Lücke, die sonst niemand besetzt? Ist der Leidensdruck groß genug, um sie in der Gesellschaft nach oben zu tragen? Gibt es Protagonisten, die sich zur richtigen Zeit an die Spitze der Bewegung setzen? Die Politikwissenschaft versteht solche Bewegungen als „Vorfeldorganisationen“ von Parteien, die Anliegen der Gesellschaft artikulieren, die von der Politik nicht ausreichend wahrgenommen werden. So entstand aus der Arbeiterbewegung einst die SPD. So eine Transformation braucht Zeit. Dass eine Bewegung aus dem Nichts zu entstehen scheint und binnen weniger Monate eine Regierung stellt, ist selbst in Zeiten „wachsender demokratischer Dynamik“, wie es der Demokratieforscher Sebastian Kneip vom Wissenschaftszentrum Berlin nennt, bemerkenswert. Emmanuel Macron ist es gelungen.
Entkrustung in Frankreich
Olivier Fleckinger, Unternehmer aus Frankreich, wohnt seit fünf Jahren in Berlin. Der 37-Jährige hat sich für Macron eingesetzt, indem er in der deutschen Hauptstadt einen lokalen Ableger von „En Marche“ gegründet hat. Eigentlich hatte er sich vor zehn Jahren geschworen: Politik, das war’s. Damals schon durchzog Aufbruchstimmung das Land, mit der Union für die Französische Demokratie (UDF) wollte François Bayrou ebenfalls die verhärteten Fronten zwischen Rechts und Links auflösen. Fleckinger engagierte sich, rührte auf Wahlveranstaltungen die Werbetrommel. Doch trotz aller Euphorie schaffte es Bayrou nicht in die Stichwahl. „Ich war total enttäuscht“, sagt Fleckinger, „und überzeugt, dass das verkrustete System in Frankreich nicht aufzubrechen ist, niemals.“
Doch als er vor fünf Jahren Macron erblickte – im Fernsehen, als junger Berater für Wirtschafts- und Finanzpolitik unter François Hollande – war er sofort begeistert. Seine Art zu reden, sein Auftreten, kein Bürokrat, sondern Visionär, einer, der Größeres vor hat im Leben. Gespannt verfolgte Fleckinger Macrons Werdegang: Seinen Aufstieg vom Berater zum Wirtschaftsminister, die Konflikte mit Parteigenossen und Gewerkschaftlern, wie Hollande ihm mit Entlassung drohte und Macron dann freiwillig zurücktrat, um kurz darauf im April 2016 seine eigene Bewegung „En Marche“ zu gründen.
Für Fleckinger hat Macron ziemlich viel richtig gemacht, allen voran: Er lehnt Vorschläge nicht ab, nur weil sie den einen „zu links“, den anderen „zu rechts“ sind. So lange die Richtung stimmt – pro Europa, mehr Moral, liberaleres Arbeitsrecht, Förderung der Abgehängten –, ist für ihn vieles denk- und machbar. Er verlässt sich nicht auf Metastudien von namhaften Umfrageinstituten, „er macht sich gern selbst ein Bild“, so Fleckinger. Für sein Wahlprogramm klapperten 5000 Freiwillige 300.000 Haushalte ab. Fleckinger: „Für uns Franzosen ein totales Novum, das gab es bis dahin nicht.“ Und, dritter Punkt, er hat die Hürde, sich politisch zu engagieren, tiefer gelegt: Nur wenige Klicks auf der Homepage und man ist bei „En marche“ dabei, kein Antrag, kein Beitrag, keine Verpflichtung.
Sicher, Macron hat auch gewonnen, weil er Macron ist: jung, leidenschaftlich, charismatisch, für viele ein guter Typ. Dennoch hält Fleckinger das Gerede von historischer Lichtgestalt und einzigartigem Glücksfall für überzogen. „Visionäre gibt es immer und überall. Doch sie werden oft nur dann gesehen und gehört, wenn der Leidensdruck hoch genug ist.“ In Frankreich war das der Fall, die Zukunft stand mit der rechtsextremen Herausforderin Marine Le Pen tatsächlich auf der Kippe.
Das neue Schwarz
Dass eine vergleichbare Implosion auch in Deutschland die Parteienlandschaft sprengen könnte, hält der Demokratieforscher Sebastian Kneip für wenig wahrscheinlich. „Die Verkrustungen sind weniger ausgeprägt, die Parteien passen sich schneller an.“ So experimentiert die SPD beispielsweise mit Schnuppermitgliedschaften, lädt bei lokalen Diskussionsrunden auch Nichtmitglieder zur Debatte und lässt bei wichtigen Entscheidungen die Parteibasis abstimmen. Die Grünen verstärken direktdemokratische Elemente. Die CDU hat eine „Kommission zur Modernisierung und Öffnung“ auf die Beine gestellt. Mittendrin: Diana Kinnert.
Im Bistro Fechtner duftet es nach Ingwertee und frischem Salat. Die Sonne scheint auf die Sitzstufen vor der Glasfront, draußen donnert der Verkehr über die Torstraße im Herzen Berlins. Wie eine CDU-Funktionärin sieht Diana Kinnert nicht aus, eher wie ein Hiphop-Girl. Schwarzes Basecap über den langen dunklen Haaren, Karohemd, Röhrenjeans, Sneakers. Kinnert beißt in ihr Mozzarella-Avocado-Sandwich und grinst. Sie weiß, dass sie irritiert. Das gehört zum Programm. Ihr Credo: „Mach dich laut, wo du nicht einverstanden bist. Deshalb bin ich nicht falsch in der CDU. Gerade dort bin ich richtig.“ Wer eine Partei von innen verändern will, muss bei Differenz ansetzen.
Natürlich hat Kinnert vorher in „Stiftung-Warentest-Manier“ gecheckt: Welche Partei passt im Grundsatz zu meinen Überzeugungen? Für sie zählte dabei weniger die Programmatik, sondern ihre Herleitung – das Menschen- und Gesellschaftsbild. Im Christdemokratischen, dem bunten Mix von Christlich-Sozialen, Liberalen und Konservativen fand sich die Tochter eines polnischen Aussiedlers und einer philippinischen Katholikin wieder. Mit Vielfalt ist sie aufgewachsen. Zwischen der Arbeiterstadt Wuppertal und dem bürgerlichen Bergischen Land. Erst in der Hiphop-Szene des städtischen Gymnasiums mit hohem Migrationsanteil, später in der katholischen Schule der Bürgerkinder. Eine Jugend zwischen Messdiener und Frauenfußball auf höchstem Niveau. Zweimal hat sie für die DFB-Juniorinnen gespielt.
Als Diana Kinnert mit 17 in die CDU eintritt, will sie sich „geltend machen, dort wo es am meisten bewirkt“. Parteien, davon ist sie überzeugt, sind auch heute „die wichtigste Brücke zum Parlament“, zur Gestaltungsmacht. Staubige Ortsvereinsrunden, null Willkommenskultur, Säle voller weißhaariger Männer, eine „Parallelgesellschaft“, mit der sie kaum etwas verbindet. All das hat auch Kinnert erlebt, abgeschreckt hat es sie nicht. Im Gegenteil.
Denn allzu oft stieß sie auf Neugier, wenn sie die Bedürfnisse der Jungen schilderte. Stimmt, junge Migrantinnen haben wir hier nicht, richtig, für Studenten im Auslandssemester sind Pflichtsitzungen im Kreisverband eine Hürde für die Mitgliedschaft. Kinnert merkt: Da geht was. Offenheit ist da. Sie startet einen Blog mit Ideen zur Modernisierung der Partei. Organisiert politische Stadtrundgänge und Aktionen für soziales Engagement. Diskutiert Positionspapiere in Online-Foren, koordiniert sich mit Mitstreitern über Facebook, entwickelt Ideen für bundesweite Arbeitsgruppen, die über Videokonferenzen und Skype zusammenarbeiten, schlägt vor, eine Crowdfunding-Plattform zur Wahlkampf-Finanzierung für junge Parteikandidaten aufzuziehen, entdeckt eine App, mit der sich die Stimmung zu einzelnen Themenfeldern in der Partei unkompliziert messen lässt.
Als Mitglied der Modernisierungs-Kommission kann sie viele Vorschläge beim Parteitag durchsetzen. Mehr Antragsrechte für Mitglieder, Betreuer für Neumitglieder, digitale Aktivitätsrundschau. Fertig ist die 26-Jährige noch lange nicht. Für ihre Ideen für einen „modernen Konservativismus“ trommelt sie in ihrem gleichnamigen Buch. „Es dauert, bis sich eine Partei reformiert. Aber es geht“, sagt Kinnert, steckt ihr Handy ein und steht auf. Der nächste Termin wartet schon. „Für mich ist die Partei ein wunderbarer Instrumentenkoffer, um etwas in Bewegung zu bringen.“
Parteigründung als Systemhack
Der Satz hätte auch von Susanne Wiest sein können. Wenn die 50-Jährige von ihrem Parteiengagement erzählt, fallen Sätze wie: „Parteigründung ist eine Art Systemhack“, „Wahlzettel sind kostenlose Flyer“, „auch eine chancenlose Direktkandidatur ist das Ticket zu Podiumsdiskussionen.“ Was spöttisch klingen mag, ist Wiest ein aufrichtiges Anliegen: Sie möchte das Thema „bedingungsloses Grundeinkommen“ voranbringen, deshalb hat sie sich im März 2017 der Ein-Thema-Partei „Bündnis Grundeinkommen“ angeschlossen, heute ist sie Vorsitzende.
Für Wiest ist das „die erste kluge Lösung“ für eine soziale Schieflage, die sie schon seit mehr als zehn Jahren beobachtet. Ihr Aussteigerleben – Bauwagenkolonie in Berlin, Gartenparzelle in Potsdam, Töpferhof in Mecklenburg Vorpommern – hat sie sensibilisiert für die Nöte der Menschen. Wie oft hat sie in ihrem Dorf beobachtet, dass es manchmal nicht mehr für das Nötigste reicht, selbst mit zwei Jobs. Auch bei ihr selbst, als Tagesmutter seit Jahren am Minimum, wurde es stets knapper. „Ich spüre, dass sich die Gesellschaft verändern will“, sagt Wiest. Endlich.
Wie viele Stimmen das Bündnis Grundeinkommen bekam, ist nicht das Wichtigste. Entscheidend ist: Das Wahlangebot gibt jedem Bürger die Möglichkeit, das Thema rechtsverbindlich nach vorn zu pushen. Ein Signal zu setzen an alle Player in der Politik: Das wollen wir, kümmert euch. Schon zeigt der Systemhack Spuren: In Schleswig-Holstein hat die Koalition das bedingungslose Grundeinkommen auf die Tagesordnung gesetzt, nach neuesten Umfragen haben 70 Prozent der Deutschen von der Idee gehört, 52 befürworten sie. Was, wenn die Partei, eines Tages, ihr Ziel erreicht hat? Wiest lacht. „Dann lösen wir sie wieder auf.“
Dickbrettbohrer
Sicher, das kann dauern. Ohne langen Atem geht es nicht im politischen System einer komplexen Gesellschaft. „Politik ist ein permanenter Aushandlungsprozess, Kompromisse suchen braucht Zeit und Durchhaltekraft“, sagt Parteienforscher Weßels. Viele Abgeordnete verfolgen über zehn Jahre ein Lebensprojekt, bis irgendwann ein Gesetz daraus geworden ist. Beim Grünen Volker Beck dauerte es sein ganzes Politikerleben lang. 1987 wurde er Schwulenreferent der grünen Bundestagsfraktion, 1992 startete er die erste Kampagne für die Ehe für alle – und im Juni 2017 wurde sie beschlossen, auf Becks allerletzter Sitzung als Bundestagsabgeordneter. Weßels weiß, wie leicht man dieses beharrliche Bohren dicker Bretter von außen übersieht. Wie schnell Ergebnisse politischer Aushandlungsprozesse als Wählerverrat wahrgenommen werden. Die SPD stimmt der Vorratsdatenspeicherung zu, die CDU lässt sich auf den Mindestlohn ein. „Doch der Kompromiss ist kein Scheitern, sondern gerade Merkmal demokratischen Regierens.“
Christoph Giesa will verhindern, dass die neue Demokratielust wieder abschwillt. Giesa ist mit dem Politikbetrieb vertraut: Schon als Jugendlicher ging er zur FDP. Er stammt aus Kirschweiler im Hunsrück, mit zeitweilig bis zu 30 Prozent eine der Hochburgen der Liberalen in Deutschland. Später verpasste er als Spitzenkandidat der FDP Rheinland-Pfalz für die Europawahl nur knapp den Einzug ins Parlament. Den Aufstieg und Fall der FDP hat er hautnah miterlebt. Als das innerparteiliche Chaos zu groß wurde, alle Reform-Ansätze im Sumpf der parteiinternen Querelen erstickten, trat er aus. Als die Partei 2013 die Quittung bekam und aus dem Bundestag gekegelt wurde, trat er noch am Wahlabend wieder ein. „Jetzt ist die Zeit, Debatten zu führen.“ Sein Ziel: Die FDP von innen erneuern. Sie zu der Partei machen, die sie sein könnte. Für die der Kern des Liberalismus eine aufrechte Allianz von Freiheit und Individualismus ist: „Chancenliberalismus“ für alle.
Viele trauen es ihm zu. Giesa gilt als Pionier des neuen politischen Engagements, mit seiner Facebook-Kampagne für die Wahl Joachim Gaucks zum Bundespräsidenten hat er schon 2010 den Politikbetrieb gründlich aufgerüttelt. „Ohne mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, können wir uns nicht weiterentwickeln“, sagt Giesa, „Politik, das sind wir alle.“ Deshalb will er die Bürger mehr einbeziehen. Sie per Los in die Landesparlamente holen, in Regionalkonferenzen und Onlineabstimmungen an den Debatten beteiligen. Loslaufen und ausprobieren. „Experimentieren muss unsere Haltung werden.“
In Kreuzberg ist das Experiment in vollem Gange. Im Hinterzimmer des Restaurants Weltlaterne stehen Griechischer Salat und Calamaris auf den Tischen, 25 Liberale drumherum. Moderne Fotografien an den Wänden, Szeneflair. Auf den ersten Blick scheint es nicht zu passen: FDP mitten in der grünen Multikultiwelt zwischen Kottbusser Tor und Paul-Lincke-Ufer, eine Minderheit. Doch dieser liberale Kreisverband ist bunt wie der Kiez. Da ist Carl, der gebürtige Niederländer, der sich für eine schnellere Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt einsetzt. Da ist Max, der den Neoliberalismus mit Verantwortung bekämpfen will. Da ist Marlene, die eine offene Gesellschaft im Kiez bewahren will. Da ist Dominique, dem es gefällt, dass er sich hier leichter einbringen kann als in großen Verbänden. Sie haben Giesa eingeladen, um über den Umgang mit der AfD zu diskutieren, Giesa hat dazu für die Friedrich-Naumann-Stiftung eine Broschüre geschrieben.
Doch schnell geht es um anderes: Was heißt das überhaupt, liberal, im Jahr 2017? Wie können wir die Ideen der Liberalen in die Welt tragen? „Ihr müsst raus aus der Bubble, seid Ansprechpartner auch für die, die euch fremd sind“, ermuntert Giesa. „Vernetzt euch mit den neuen Bewegungen, ladet zu überparteilichen Debatten ein. Wenn wir eine liberale, lebendige Zivilgesellschaft sein wollen, müssen wir Teil davon sein.“
Loslaufen. Ausprobieren. Und aufmischen.