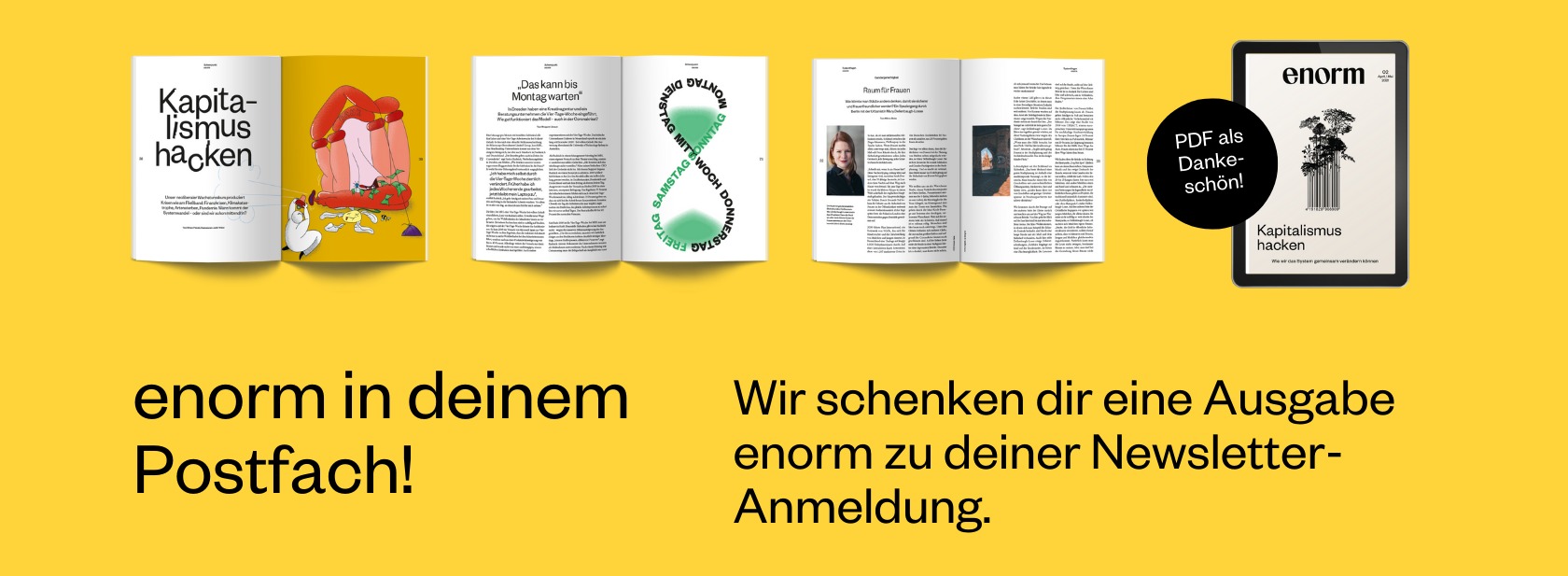7 minuten
2 April 2017
Feierabend im Jahr 2034: Der Verkehr gleicht einem lockeren Strom. Ruhig steuern die selbstfahrenden Autos über den Asphalt. Lassen Radfahrer passieren, geben Fußgängern Raum. Kein Hupen, kein Fluchen. In Hotels begrüßen dreidimensionale Avatare mit freundlicher Stimme die Gäste, an Kinokassen kassieren Computer. Die künstlichen Mitarbeiter in den Banken beraten geduldig, faktenreich und vollautomatisiert. Überall gehen intelligente Maschinen den Menschen zur Hand, bereiten medizinische Daten auf und helfen Senioren aus den Betten, spielen Karten mit den Kindern, assistieren in Fabrik und Labor.
Das Smartphone ist längst mehr als ein Telefon und Nachrichtentool, es ist ein Sparringspartner für anregende Debatten, voller Argumente und gutem Rat. Denn wie all die digitale Technik, die den Menschen umgibt, versteht es Gesten und Mimik, kann Texte, Bilder, Videos interpretieren und selbstständig dazulernen. Mensch und Maschine wachsen zusammen.
Was wie Science-Fiction klingt, hat längst begonnen. Die digitale Revolution ist dabei, die Gesellschaft so deutlich zu verändern wie keine andere Entwicklung seit der Industrialisierung. Künstliche Intelligenz, Robotik, Industrie 4.0 – ein Alltag, der rundherum und in Echtzeit vermessen und vernetzt wird.
„Die Gesellschaft ist von einer digitalen Hülle umgeben“, sagt Oliver Dziemba vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg. „Und das ist erst der Anfang.“ Denn die Transformation entwickelt sich exponentiell. Sensoren, Kameras, Laser, Radar werden immer kleiner und billiger, Algorithmen leistungsfähiger.
Bis 2040 wird sich allein die Rechenleistung vertausendfachen. „Wenn die heute noch meist getrennten Entwicklungsstränge zusammenwachsen“, schätzt Buchautor Ulrich Eberl („Smarte Maschinen“), „wird dies alle Lebensbereiche radikal verändern“.
Das ist eine Chance. Zum Beispiel für nachhaltige Energiesysteme, die Angebot und Nachfrage optimal ausbalancieren; für die Industrie, in der sich effizienter und flexibler fertigen lässt; für die Medizin, die Millionen Krankheitsdaten bei Diagnose und Therapie nutzen kann; für die Versorgung von einer Milliarde Senioren, die es weltweit mehr geben wird als heute; für den Wissensaustausch und die Bildung von Millionen Menschen auf der Welt.
Und doch, es gibt Risiken, und sie schieben sich immer deutlicher in den Vordergrund. Ging es zunächst um die Sicherheit von Daten und die Frage, wer alles mitliest und -hört, wenn man Skype und Whatsapp nutzt oder E-Mails verschickt, so haben die politischen Erschütterungen der vergangenen Monate offengelegt, wie zerbrechlich die Demokratie ist und wie leicht sie sich durch neue Technologien wie „Social Bots“ aushöhlen lässt: Im US-Wahlkampf tarnten sich maschinell gesteuerte Programme bei Twitter und Facebook als echte User und machten zu tausenden Stimmung für Donald Trump.
Die Welt als Riesencomputer
Hinzu kommt, dass der Mensch dem Wachstum der Technologien nicht mehr folgen kann. Lange haben wir das verdrängt. Kein Wunder, denn wie man aus der Entscheidungsforschung weiß, ist der Mensch darauf gepolt, die Folgen zeitnaher Ereignisse zu überschätzen und Entwicklungen in der Zukunft zu unterschätzen. Nun machen Experten mit Nachdruck klar: Es ist Zeit, diese Wahrnehmung gerade zu rücken.
Yvonne Hofstetter ist Chefin von Teramark Technologies in Zolling bei München und entwickelt seit 18 Jahren Maschinen, die immer intelligenter werden. Trotzdem hat sie ein Buch mit dem Titel „Ende der Demokratie“ geschrieben. „Wir sind dabei, die Welt in einen Riesencomputer zu verwandeln“, sagt sie. „Alles wird gemessen, gespeichert, analysiert und prognostiziert, um es anschließend zu steuern und zu optimieren.“ Eben nicht nur die Lieferkette einer Jeans, den Wartungszyklus einer Flugzeugturbine. Sondern auch unser Denken, Fühlen, Handeln.
Hier fängt für sie das Problem an: „Wenn wir nicht aufpassen, degradieren wir uns selbst zum Ding.“ Und verlieren, was wir in Jahrzehnten und Jahrhunderten aufgebaut haben: Freiheit und Selbstbestimmung, Menschenwürde, die Möglichkeit, sein Leben so zu gestalten, wie man möchte. Von „Konsumentensteuerung“ sprechen die Firmen im Silicon Valley unverhohlen, die die Digitalisierung vorantreiben. Hofstetter fasst sie unter dem Akronym GAFAM zusammen: Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft.
Stefan Klauser arbeitet seit Anfang 2016 am Lehrstuhl für „Computational Social Science“ an der ETH Zürich. Für ihn ist die Möglichkeit, dass die Welt ins Chaos stürzt, durchaus gegeben. Vor allem, weil wir im Moment noch in die falsche Richtung liefen. Die Menschen würden nicht befähigt, sondern immer stärker bevormundet und voneinander isoliert. Stichwort: „Filterblasen“. Um bessere Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die das Leben bequemer machen, erhält jeder personalisierte Informationen – und bekommt nur angeboten, was er aufgrund seiner Suchanfragen, Einkäufe, Kontakte und Bewegungsmuster ohnehin schon kennt. Die Folge: Der Blick fürs große Ganze geht verloren. Der Zusammenhalt schwindet.
Klauser erzählt von China und dem „Citizen Score“, den man via App abrufen kann. Je höher, desto besser die Reputation: Ab 600 Punkten gibt es günstige Kredite, ab 700 steigen die Chancen auf ein Visum nach Singapur oder Europa. Positiv auf den Kontostand wirkt sich der Kauf bestimmter Güter ebenso aus wie ein gut gefülltes Bankkonto. Wer sich hingegen auf Social-Media-Plattformen regimekritisch äußert, mit den falschen Freunden kommuniziert, unerwünschte Webseiten ansteuert, der wird abgewertet.
Der „Citizen Score“ ist freiwillig, trotzdem machen Tausende mit und stacheln sich auf Twitter gegenseitig an. Ab 2020 soll er Pflicht werden – und kann mit über die Vergabe von Wohnungen, einer schnellen Internetverbindung oder den Zugang zu Jobs in Verwaltung, Medien oder Unternehmensführung entscheiden.
Deutschland ist nicht China. Aber die Verhältnisse verschieben sich auch hier. Udo Hahn, Computerlinguist an der Universität Jena, rechnet vor: Allein die NSA habe schätzungsweise ein Zettabyte – eine 10 mit 21 Nullen – Kommunikationsdaten gespeichert, Google, Twitter und Facebook verfügen über riesige Datensätze. Nie, so Hahn, habe sich das Alltagsverhalten der Menschen so leicht, so lückenlos, so unbemerkt erfassen lassen wie heute.
Und wo die Software inzwischen sogar emotionale Muster im Meer der Kommunikation zu entschlüsseln versteht – etwa anhand des Erregungsgrades in Chats oder Tweets – könne sie diese immer leichter beeinflussen. Ohne die computergenerierten Diskussionsbeiträge von „Social Bots“ wäre der US-Wahlkampf vielleicht anders ausgegangen. „Wenn die Software die Mechanismen verstanden hat, nach denen Meinungsbildung funktioniert, kann sie diese gezielt manipulieren“, sagt Hahn. „Die Tools der modernen IT können selbst hierzulande für Interessensgruppen zu einem hochgradig effektiven Herrschaftsinstrument werden, aus dem der Einzelne keine Chance hat auszubrechen.“ Sicherheitshalber bleibt Udo Hahn Social Media daher eher fern.
Da bleibt nur: Aufklären
Ist das kulturpessimistisch? Fortschrittsfeindlich? Markus Beckedahl, Chefredakteur der Debattenplattform Netzpolitik.org und Gründer der größten europäischen Internetkonferenz Re:Publica, sagt „mitnichten“ und nennt es eine „schizophrene Situation“, in der er sich befinde. Er habe ein Smartphone mit diversen Apps, obwohl er wisse, dass „es eine Wanze ist“. Wenn er „sensible Gespräche“ führe, lasse er das Smartphone zu Hause. Viele seiner Kollegen sind radikaler: Skype, Facebook und Twitter kommen für sie nicht in Frage. Yvonne Hofstetter benutzt nicht mal ein internetfähiges Handy.
Die Expertin für künstliche Intelligenz vergleicht die Digitalisierung mit dem Imperialismus des 19. Jahrhunderts. Auch damals waren Unternehmen auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern. In den eigenen nationalen Grenzen war nicht mehr viel zu holen, das Wachstum stagnierte. „Die Kolonialisierung war rein wirtschaftlich getrieben, genauso wie die Digitalisierung heute – und sie fand in den Anfangsjahren ebenfalls ohne jegliche staatliche Kontrolle oder politische Einflussnahme statt.“
Resa Mohabbat Kar, Geschäftsführer des Think Tanks Collaboratory, will das nicht hinnehmen. Keine Frage, er ist zutiefst überzeugt von der Digitalisierung. Sich so schnell Wissen der Welt zu erschließen, sich auf Protest-Plattformen machtvoll gegen Missstände zu engagieren – wo konnte man das je zuvor? Welch gewaltiger zivilisatorischer Mehrwert! Die Entwicklung zurückdrehen zu wollen, sei ebenso illusorisch wie falsch. „Aber wir müssen sie mitgestalten“, sagt Kar. Denn automatisch steckt jeder bis zum Hals mittendrin. Wenn er arbeitet, lernt, liebt. „Eine stille Revolution krempelt gerade unser Leben um und viele Menschen haben nicht mal in den Grundzügen eine Vorstellung, was da auf uns zukommt“, sagt er. Gerade mal 14 Prozent der Deutschen können laut D21 Digital-Index 2016 etwas mit dem Begriff „Big Data“ anfangen. Da bleibt nur: aufklären. Experten zusammentrommeln. Debatten anzetteln.
Seit 2010 bringt Collaboratory Experten, Politiker und kritische Aktivisten an einen Tisch. Diese „Initiativen“ tauschen sechs Monate lang Argumente aus, erarbeiten Strategien zu Themen wie digitale Menschenrechte, Privatsphäre oder Digitalisierung in der Bildung und auf dem Land. Danach wird damit vor einem größeren Publikum geklappert. Veranstaltungen, Aktionen, Podiumsdiskussionen – egal wo Mohabbat Kar hinkommt, immer schallt es ihm wie ein Mantra entgegen: Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert – da kann man sowieso nichts machen.
„Das ist blanker Unsinn“, sagt der Collaboratory-Chef. Natürlich könne man gestalten. „Es ist an uns zu entscheiden, ob wir nicht von Plattformen verlangen wollen, dass sie kenntlich machen: Spricht da ein Algorithmus oder ein Mensch? Ob privatwirtschaftliche Unternehmen digitale Helfer anbieten dürfen, wie die smarte Lautsprecherbox Amazon Echo, die unser Verhalten daheim kontinuierlich aufzeichnen.“
Diskussion um Zukunft der Digitalisierung „eine riesige Chance“
Knapp 800 Kilometer entfernt sitzt Jan Philipp Albrecht im fünften Stock des EU-Parlamentsgebäudes in Brüssel. Seit sieben Jahren streitet der Vertreter der Grünen für ein zeitgemäßes Regelwerk in der digitalen Welt. „Jeder EU-Bürger muss sich darauf verlassen können, dass es auf dem digitalen Markt Standards gibt.“
Es sei wie bei einem Auto: „Wenn es in der EU verkauft werden darf, hat es eine Bremse. Punkt.“ Noch sei die Situation katastrophal, sagt Albrecht, „in jedem Land gibt es eine andere Rechtslage, fast nirgends passt sie zu den Anforderungen des digitalen Zeitalters.“ Im Frühjahr 2016 hat die EU die Datenschutzgrundverordnung verabschiedet, seit 2018 braucht jedes Unternehmen, das in Europa tätig ist, beispielsweise die Einwilligung seiner Kunden, deren Daten zu verarbeiten. Auf Verlangen müssen Sucherergebnisse gelöscht werden. „Recht auf Löschen“, heißt das im Juristensprech
Als „Zuckerbergbesieger“ feierte die „FAZ“ Verhandlungsführer Albrecht. Der 33-Jährige sagt, es gebe noch viel zu tun bei der Digitalisierung. Die Bandbreite der Themen ist riesig: Wer hat überhaupt das Recht mitzuverfolgen, wer welche Seiten im Internet besucht, wer mit wem wann telefoniert? Wie behält man die Kontrolle über die Daten? Wer haftet, wenn beim Einsatz von Krankenpflege- oder Kriegsrobotern etwas schief läuft?
Was Jan Philipp Albrecht besonders umtreibt: Noch befinden wir uns in Deutschland in einem einigermaßen sicheren Gesetzesraum. Doch was, wenn sich die Machtverhältnisse verschieben? Kaum war der Brexit beschlossen, verabschiedete Großbritannien den „Investigatory Powers Bill“, ein Schnüfflergesetz zur anlasslosen Massenüberwachung. In so einem Fall bliebe nur: weniger Daten erheben. Indem der Staat etwa Anonymisierungsdienste fördere, wie Albrecht sagt, oder digitale Anwendungen, die möglichst wenig in die Privatsphäre eingreifen. „Die Transformation ins digitale Zeitalter gehört schleunigst ins Zentrum der Aufmerksamkeit – von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.“
Markus Beckedahl von Netzpolitik.org ist vorsichtig optimistisch. Wenn er im Ausland unterwegs ist, merke er, dass „nirgendwo sonst so offen, so ausführlich über die Auswirkungen der Digitalisierung gesprochen wird.“ Nicht in Frankreich. Nicht in Australien. Schon gar nicht in den USA. „Das ist eine riesige Chance.“
Als der Blogger 2015 des Landesverrats bezichtigt wurde, weil er vertrauliche Schriftstücke des Verfassungsschutzes veröffentliche, schwappte eine Welle der Solidarität durchs Land. „Von vielen wurde das offene Netz als gottgegeben angesehen – allmählich merken sie, dass es sich gerade schließt.“
Datenschutzexperten vergleichen das allmähliche Erwachen mit der Entstehung der Umweltbewegung in den 60er-Jahren: ein Aufstand, der sich erst formierte, als die Umweltverschmutzung weithin sichtbar wurde. Noch sei der Sprung zu schaffen, sagt Stefan Klauser, hin zu einer „partizipativen digitalen Gesellschaft, die auf kollektive Intelligenz und Selbstorganisation fußt“.
Mit Komplexitätsforscher Dirk Helbing tüftelt er an der ETH Zürich an einem globalen Bürgernetzwerk, das zeigen soll: Es geht auch anders. Der Name: „Nervousnet“. Jeder kann sich daran über eine App beteiligen. Im ersten Schritt werden mittels Sensoren im Smartphone Temperatur, Helligkeit, Lärm und Bewegungen erfasst. Später sollen auch Messfühler in Kühlschränken oder Schuhen Daten beisteuern. „Jeder Teilnehmer bestimmt selbst, welche Informationen er anonymisiert und sicher einspeisen möchte“, sagt Klauser, „und jeder hat gleichberechtigt Zugriff darauf, um selbst das Netz weiterzuentwickeln, neue, clevere Services und Produkte anzubieten.“
„Letztlich geht es auch um neue Jobs“, sagt Klauser: „50 Prozent der Berufe, wie wir sie heute kennen, wird es in zehn bis 20 Jahren nicht mehr geben“. Der Rohstoff der Zukunft – Daten – dürfe nicht länger wie Gold im Tresor lagern. Die Menschen müssten befähigt werden, damit zu arbeiten. Anfang 2016 fand der erste „Hackathon“ statt. Menschen aus ganz Europa folgten dem Ruf nach Zürich, um gemeinsam Lösungen zu finden. Das passende Motto: „Let us build digital democracy together.“