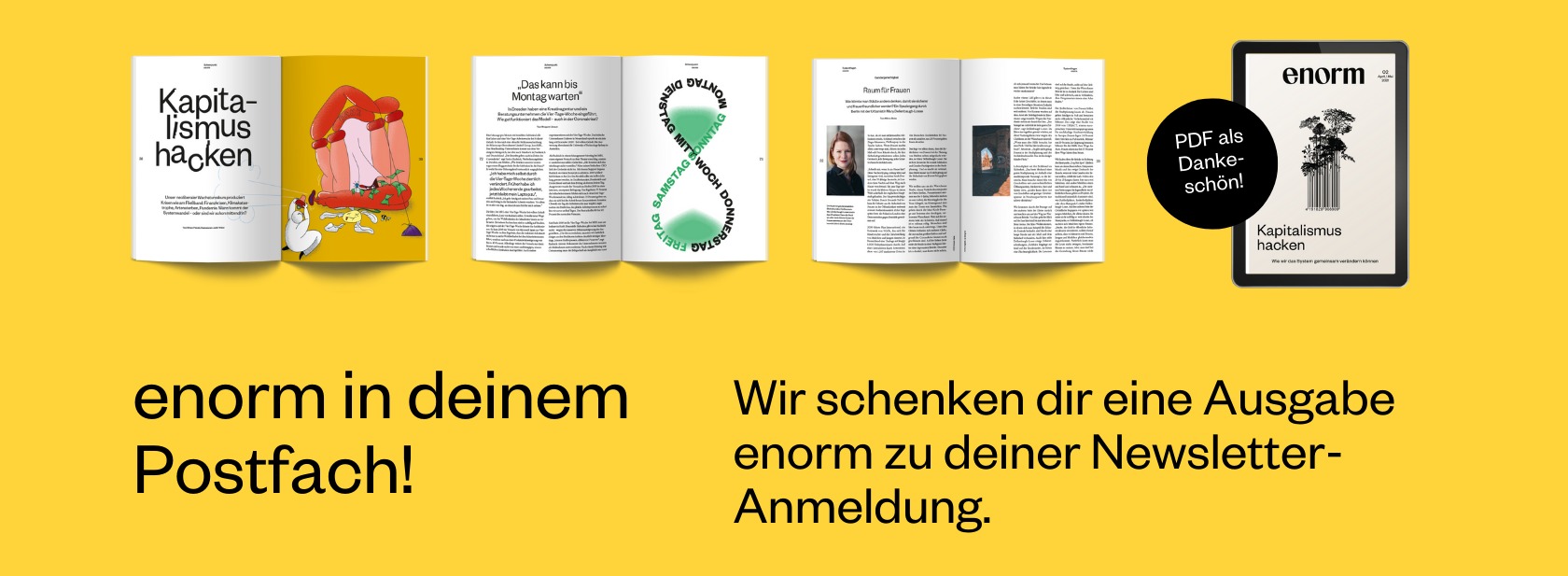Beruf und Arbeitswelt
Digitaler Sprengstoff
8 minuten
19 June 2016
)
Arbeiten von überall – klingt verlockend, doch wird Crowdworking oft schlecht bezahlt
8 minuten
19 June 2016
Zur Jahrtausendwende schien der kanadische Bergbaukonzern Goldcorp dem Untergang geweiht zu sein. Analysten bescheinigten der damals 50 Jahre alten Goldmine Red Lake in der Provinz Ontario das baldige Sterben. Doch Unternehmensgründer Rob McEwen hatte eine Idee. Er veröffentlichte sämtliche seit 1948 gesammelte Daten über das altehrwürdige Areal im Internet und verkündete: „Wir bitten die Welt, uns mitzuteilen, wo wir die nächsten sechs Millionen Unzen Gold finden.“
Nie zuvor hatte ein Minenbetreiber derartige Betriebsgeheimnisse preisgegeben. McEwen lobte 575.000 Dollar Belohnung aus für die besten Hinweise, wo sich das Buddeln lohnen könnte und nannte sein Projekt „Goldcorp Challenge“. Schon bald war klar: Der Begriff „Rush“ hätte besser gepasst. Weit mehr als 1000 Geologen, Studenten, Mathematiker, Unternehmensberater, Militärangehörige und sonstige Glückspilze aus etlichen Ländern beteiligten sich an dem Wettbewerb. Sie identifizierten 110 Orte – unter denen einige Volltreffer waren.
Goldcorp fand nach eigenen Angaben acht Millionen Unzen Gold, das sind 227 Tonnen. Der Börsenwert des Konzerns stieg von 100 Millionen auf neun Milliarden US-Dollar, heute liegt er bei über 14 Milliarden. Dass eine Herde virtueller Goldsucher, die nie in Red Lake war, binnen weniger Tage das schaffte, wofür seine Ingenieure ungefähr drei Jahre und viel Geld gebraucht hätten, verblüffte selbst McEwen. Und er prophezeite: „Das ist ein Teil der Zukunft.“
Crowdworking ist ein Teil der Zukunft
Auch wenn es den Begriff Crowdworking, zusammengesetzt aus „Crowd“ für Masse und „Working“ für arbeiten, im Jahr 2000 noch nicht gab: Das von McEwen erstmals global getestete Prinzip hat Maßstäbe gesetzt. Inzwischen überlassen Unternehmen zahlreiche Aufgaben vom Minijob bis zum vollständigen Arbeitsprozess der Schwarmintelligenz – und es werden täglich mehr.
Nach Einschätzung der Weltbank sind weltweit 48 Millionen Crowdworker aktiv, die 2016 einen Umsatz von fast fünf Milliarden US-Dollar erzielen werden. Bis Ende des Jahrzehnts soll es 112 Millionen von ihnen geben und der Betrag sich verfünffachen. Andere Prognosen erwarten noch höhere Zahlen. „Crowdworking ist nicht – wie so oft behauptet – die Zukunft der Arbeit, aber es hat Zukunft. Jedenfalls ist das Wachstumspotenzial in vielen Bereichen enorm. Und es geht ja gerade erst richtig los“, sagt Jan Marco Leimeister, der als Professor der Unis in Kassel und St. Gallen die digitale Wirtschaft erforscht.
Die Wertschöpfung geschieht immer häufiger digital
Der neueste Schrei der Globalisierung ist eine Konsequenz aus technischem Fortschritt, dem Umstand, dass Wertschöpfung immer häufiger in virtuellen Zusammenhängen geschieht, und dem Trend, das Leben möglichst frei von Zwängen zu gestalten: Nicht „ich gehe zur Arbeit“, sondern „die Arbeit kommt zu mir“, lautet das Motto. Mit Badehose, Zahnbürste und Laptop auf die sonnige Insel und von dort arbeiten, das ist verlockender als der tägliche Gang ins Büro. „Was, wie und wann er es tut, kann jeder Einzelne ganz individuell entscheiden. Das ist für viele attraktiv“, erklärt Leimeister mit Verweis auf diverse Studien.
Als Schaltstellen fungieren Portale wie Clickworker, Jovoto, AppJobber, Twago, Streetspotr und Freelance. In der Regel läuft es so: Auftraggeber stellen Jobs ein, die binnen weniger Minuten oder in einigen Monaten erledigt werden sollen. Und je nachdem, ob es sich um lokale oder grenzüberschreitende Aufträge handelt, antwortet die Crowd – vom heimischen Rechner aus oder von unterwegs, per Smartphone.
Bewerbungsgespräche oder gar Assessment Center? Pustekuchen. Die Arbeitsvermittler locken mit flotten Sprüchen: „Sofort und ohne Bewerbung loslegen und Geld verdienen!“ Viele Portale haben ein internes Ranking, in dem sich die Crowdworker durch Bewertungen „hocharbeiten“ können, um an besser bezahlte Aufträge zu gelangen.
Die Art der Tätigkeiten variiert stark
Die Art der Tätigkeiten variiert stark. Mal testen und bewerten die digitalen Malocher Serviceleistungen, fotografieren Straßenschilder oder Produkte in Supermärkten. Dann kategorisieren sie Waren, schreiben kurze Texte für Online-Kataloge oder notieren Öffnungszeiten. Es kann sich aber auch um Übersetzungen oder komplexe Projekte wie das Entwickeln und Testen von Software handeln. Häufig sind es Ingenieure, Techniker und IT-Spezialisten, die neben ihrer festen Arbeit versuchen, lukrative Aufträge zu ergattern.
Dass die Bezahlung unterschiedlich ausfällt, liegt auf der Hand. Mikro-Jobs werden immer mit Cent-Beträgen abgegolten. Hochwertige Dienstleistungen bringen gute bis sehr gute Stundenlöhne, leben kann man davon aber nicht, dafür sind diese Aufträge zu selten. Fakt ist aber: Wohl kein Crowdworker – zumindest in Deutschland – hat das Ziel, den Anspruch oder die Illusion, allein mit diesen Kleinstarbeiten über die Runden zu kommen. So gut wie immer – das geht aus Studien hervor – haben die digitalen Helferlein mehrere Jobs.
Die überwiegende Mehrheit der Crowdworker sind junge Menschen, oft Studenten oder Auszubildende. Die Geschäftsführerin von Streetspotr, Dorothea Utzt, macht keinen Hehl daraus, „dass der Großteil unserer Leute zehn Euro im Monat verdient. Mehr schaffen meist nur Rentner“. Bei Streetspotr sind der 35-Jährigen zufolge europaweit rund 425.000 Menschen angemeldet, 380.000 davon in Deutschland.
Auch die Bezahlung ist unterschiedlich
Utzt ist ziemlich genervt davon, dass Crowdworking in Deutschland vor allem über minimale Bezahlung wahrgenommen wird. Insbesondere Gewerkschafter sprechen von „digitalen Tagelöhnern“. Befeuert wird die Einschätzung durch Medienberichte. Der WDR zum Beispiel ließ eine junge Frau ein Portal ausprobieren. Anschließend klagte sie, „jeden Tag ein bis zwei Stunden Zeit investiert“ und nach einem Monat „ungefähr fünf Euro“ verdient zu haben.
Wer richtig gut sei, könne auf fünf Euro in fünf bis zehn Minuten kommen, behauptet Utzt. „Da muss man aber schon eine Weile dabei sein. In jedem Fall lohnen sich die Jobs nur, wenn der Crowdworker nicht irgendwohin fahren muss und vor Ort ist.“ Manch einer betrachte Suche und Zuschlag für den nächsten Auftrag als Schnitzeljagd. „Ein Blick in unsere Community lässt Pi mal Daumen den Schluss zu: Für die eine Hälfte steht das Taschengeld im Vordergrund, für die andere der Spaß. Auch Zugehörigkeitsgefühl spielt eine Rolle.“
Bei der IG Metall fällt die Betrachtung ebenfalls differenziert aus. Die Gewerkschaft befasst sich intensiv mit dem Thema, weil immer mehr ihrer Unternehmen betroffen sind. Crowdworking bedeutet zwar nicht zwangsläufig Outsourcing und Stellenabbau. Aber das Prinzip wird zunehmend auch firmenintern eingesetzt, um schneller zu werden und starre Strukturen aufzubrechen. „So innovativ Crowdworking auch sein mag: Man darf sich keine Illusionen machen“, sagt Vanessa Barth, die bei IG Metall im Vorstand sitzt und sich mit der Zukunft der digitalen Arbeitswelt befasst. Am Ende gehe es um die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse.
Die Geburt einer neuen Art der Arbeit
„Wir erleben die Geburt einer neuen Art der Arbeit. Wir wollen dabei sein und mitgestalten, statt zuzusehen und hinterher zu jammern, dass die digitale Welt über uns hereingebrochen ist“, sagt Barth auch mit Blick auf die Tatsache, dass der Zuwachs an freien Mitarbeitern die Gewerkschaften schwächen und die Zahl der Unternehmen mit Betriebsräten sinken wird. Nach Schätzungen der IG Metall, die im regen Austausch mit diversen Plattformen zu sein scheint, sind eine Million Crowdworker in Deutschland aktiv. Innovationen wie Uber aus dem Silicon Valley seien prima, allerdings nicht sozial nachhaltig, meint Barth. „San Francisco ist sozial extrem gespalten. Das müssen wir hier vermeiden. Deshalb sage ich: Standards müssen her.“
Denn klar ist: Crowdworking wird zunehmen. Die Vorteile für die Unternehmen sind zu verlockend. Statt sich einen großen Personalstamm zu leisten, werden Ausfälle bei Krankheiten oder Urlaub durch Freie kompensiert. Das ist billiger als das Anheuern von Leiharbeitern.
„Auch der Zeitgewinn ist spektakulär, weil ein Projekt in viele kleine Aufgaben zerlegt wird“, sagt Jan Marco Leimeister. Ein Beispiel: das Übersetzen eines 100-seitigen Katalogs in eine x-beliebige Fremdsprache. Statt den Auftrag einem Büro zu überlassen, bekommen Dutzende oder Hunderte Dolmetscher einige Sätze. Und die Kontrolle? „Es folgt ein weiterer Auftrag an die Crowd, die Übersetzung zu überprüfen.“
Die Arbeit wird in kleine Aufgaben geteilt
Dass so etwas auch Ängste freisetzt, liegt nah. Der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) sieht im Crowdworking zwar Chancen. Doch die Skepsis überwiegt. „In vielen Fällen geht in erster Linie Qualität verloren, der Kunde hat keine Kontrolle mehr über sie“, warnt BDÜ-Vizepräsident Ralf Lemster.
Ähnlich argumentieren Designer, Grafiker, Illustratoren und andere Spezialisten, die es mit einer speziellen Form des Crowdworking zu tun haben: dem digitalen Pitch. Beim sogenannten Crowdstorming zapfen Auftraggeber vielfach grenzüberschreitend und in Wettbewerben Wissen und Kreativität Hunderttausender an. Hier hat sich das Berliner Start-up Jovoto zum Global Player entwickelt. Nach eigener Aussage versuchen weltweit 80.000 Kreative, über das Portal Aufträge an Land zu ziehen, die als Frage verpackt werden.
Der französische Mineralölkonzern Total wollte etwa wissen, „wie die Zukunft der Tankstelle“ aussehen könnte. Das Preisgeld betrug 21.500 Euro. Der Schweizer Bonbonhersteller Ricola bot 18.000 Euro für ein „stilvolles, cooles und exklusives“ Verpackungsdesign in limitierter Auflage. Die Deutsche Bank rief dazu auf, darüber nachzudenken, wie die Beratung der Zukunft aussehen sollte – im Jackpot lagen 25.000 Euro.
Konzerne sparen Geld und baden trotzdem in einem Ideenpool
Der Vorteil beim Crowdstorming: Die ausgelobten Beträge sind im Vergleich zum Honorar für eine Agentur marginal. Umgekehrt ist der Ertrag riesig. Die Konzerne sparen Personal und Hirnschmalz und baden trotzdem in einem großen Ideenpool. Auf der anderen Seite stehen die Teilnehmer, die damit leben müssen, dass nur der oder die Sieger entlohnt werden und, manchmal, ein wenig Ruhm bekommen. Alle anderen: gehen leer aus.
Crowdstorming ist heftig umstritten. Die einen lehnen die Teilnahme kategorisch ab. Sie klagen über zu viel Schufterei für nichts, Unterbietungswettkämpfe und minimale Honorare. Die anderen sind froh, von Konzernen wahrgenommen zu werden. Gerade junge Designer betrachten die Plattformen als Chance, sich zu profilieren.
Jovoto hebt hervor: „Wir öffnen den Kreativen die Tür, für globale Organisationen zu arbeiten.“ Das Unternehmen bescheinigt sich, „die höchste Summe an Auszahlungen“ und „die fairsten AGBs“ im Crowdworking zu haben. Und nicht nur Kunden dürften ihre Favoriten wählen, 10 bis 20 Gewinner würden von der Gemeinschaft bestimmt. Kritiker entgegnen, dass die gegenseitigen Bewertungen die Einschätzung von Qualität verhindern, da in der Hoffnung gelobt werde, bei nächster Gelegenheit eine Topbewertung zurückzubekommen.
Für Berufseinsteiger durchaus lohnenswert
„Die Portale haben ihre Berechtigung. Sie sind gut für Berufseinsteiger, die sich ausprobieren wollen“, sagt Victoria Ringleb, Geschäftsführerin des Verbands Allianz deutscher Designer. „Das Hauptproblem ist, dass sie suggerieren, es handele sich um professionelles Design. Auf den Portalen tummeln sich aber viele Nebenberufler und Hobbydesigner. Der Auftraggeber weiß nicht, an wen er gerät.“
Jovoto erklärt, dank langjähriger Erfahrung brauche sich der Kunde nur durch den Prozess führen zu lassen: „Alles, was Sie tun müssen, ist sich über die großartigen Ergebnisse zu freuen.“ Ringleb hält das für PR-Hokuspokus.
Entscheidend dürften für die Auftraggeber die niedrigen Kosten sein. „Gefährdet sind alle Berufe von Sach- und Facharbeitern, zu denen sehr routinemäßige Aufgaben gehören, wie etwas sortieren, suchen oder berechnen“, sagt Arnold Picot, BWL-Professor der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Folgen für das Sozialversicherungssystem
Unabsehbar sind die Folgen für das Sozialversicherungssystem, wenn die Zahl der Freiberufler zunimmt und immer weniger in die Rentenkasse zahlen.
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hält sich 2016 bei dem Thema bedeckt – oder sie hebt es sich für den Wahlkampf auf. Die Sozialdemokratin findet zwar, dass diskutiert werden müsse, ob für Crowdworker die gesetzliche Rentenversicherung geöffnet oder ein neues berufsständisches Versorgungswerk eingerichtet werden solle. Doch sie will sich Zeit lassen. Bisher weise nichts „auf einen akuten Handlungsbedarf“ hin.
Gewerkschaftsbund sieht Handlungsbedarf
Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, sieht das anders. „Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie eine Art moderne Sklaverei entsteht, mit einem Wettbewerb um Löhne nach unten“, sagt er. Crowdworking brauche Regeln, „um Wettbewerbsverzerrungen durch Lohn- und Sozialdumping, Scheinselbständigkeit oder Steuerflucht zu vermeiden“.
Auch Unternehmen sind skeptisch. Die Telekom hat nach einem Auftrag bei Clickworker Abstand genommen. Crowdworking sei „dauerhaft kein tragfähiges Modell, da wir bewusst einer Insourcing-Strategie nachgehen und ganz im Gegenteil die externe Vergabe sukzessive zurückholen zugunsten einer Eigenfertigung“, erklärt ein Konzernsprecher. Aufgrund der Regeln für Zeit- und Leiharbeit sowie Werksverträge habe die Telekom strikte Vorgaben zur Auftragsvergabe. „Crowdworking ist für uns in dem Zusammenhang kein abgesichertes Format.“
Einige Portale bemühen sich um faire Bedingungen. Die deutschen Anbieter Streetspotr, Clickworker und Testbirds unterzeichneten einen „Code of Conduct“, in dem „ein dem Wert der Arbeit faires und angemessenes Honorar“, „Unterstützung und Feedback“ sowie „offene und transparente Kommunikation“ versprochen werden.
Portale mühen sich um faire Bedingungen
Was Crowdworkern hilft: Portale, die ihre Leute mies behandeln, können diese nicht bei der Stange halten. Dorothea Utzt von Streetspotr sagt: „Man muss sich kümmern. Wenn die Crowd nicht da ist, können wir ebenfalls unsere Arbeit nicht machen.“
Utzt hat zudem keine Probleme damit, Fragen nach Datenschutz und Privatsphäre zu beantworten. Die seien „sehr berechtigt“. Zum Beispiel, wer Crowdworkern das Recht gibt, in einen Supermarkt zu laufen, Fotos zu machen und diese digital zu verbreiten. Im Code of Conduct heißt es: „Es werden nur solche Informationen in anonymisierter Form weitergegeben, die unbedingt benötigt werden, um das Projekt und die Arbeitsweise für den Kunden nachvollziehbar zu machen.“
Ein Beispiel: Die Brauerei Paulaner hatte bei Utzt prüfen lassen, ob ihre Bierkästen in Supermärkten an der richtigen Stelle standen. Nach Darstellung einer Firmensprecherin erging der Auftrag, weil Streetspotr den Code of Conduct befolge. Das digitale Zeitalter biete neue Möglichkeiten der Marktforschung. „Dieses Angebot nutzen wir natürlich gerne.“
Die Politik wird sich vermutlich nicht nur mit den sozialen Auswirkungen von Crowdworking befassen, sondern auch mit den datenschutzrechtlichen. „Jeder Bildschirmarbeiter ist an der elektronischen Leine und kann kontrolliert werden, wo, wann und wieviel er arbeitet“, sagt BWL-Professor Picot. In den USA sollen Plattformen permanent Screenshots von ihren digitalen Arbeitsbienen angefordert haben, um nach dem Stand der Dinge zu schauen.
Amazon hat einen miesen Ruf
Einen besonders schlechten Ruf hat Amazons „Mechanical Turk“. Die Crowdworker, „Turker“ genannt, müssen es akzeptieren, wenn ihnen Auftraggeber ohne Angabe von Gründen die Bezahlung verweigern. Die US-Aktivistin Kristy Milland macht sich für Regeln stark, die weltweit gelten. Sie war viele Jahre Turkerin und arbeitete „bis zu 17 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche“. Heute hält sie Vorträge über die Problematik des Crowdworking.
Wirtschaftsforscher Jan Marco Leimeister sagt: „Man darf Crowdworking nicht zu Tode regulieren, aber wir müssen klären, was gesellschaftlich wünschenswert ist und was nicht.“ Komme es zur Rezession, seien die Aufträge nicht mehr „der nette Zweit- oder Drittjob. Dann kommt Druck auf die Preise, was potenziell hässlich werden kann.“
Als weiteres Problem sieht Leimeister, dass sich eine einzige Plattform als Global Player mit Quasi-Monopol herauskristallisieren könnte. „Der Marktführer hat dann Macht über den Crowdworker.“ Dorothea Utzt sagt dazu: „Potenzielle Investoren fragen immer danach, ob uns so etwas drohen könnte. Ich habe keine Angst davor. Aber generell können Google und Facebook alles machen.“
Update vom 5. Juni 2019: Prof. Arnold Picot von der LMU München ist im Juli 2017 verstorben.