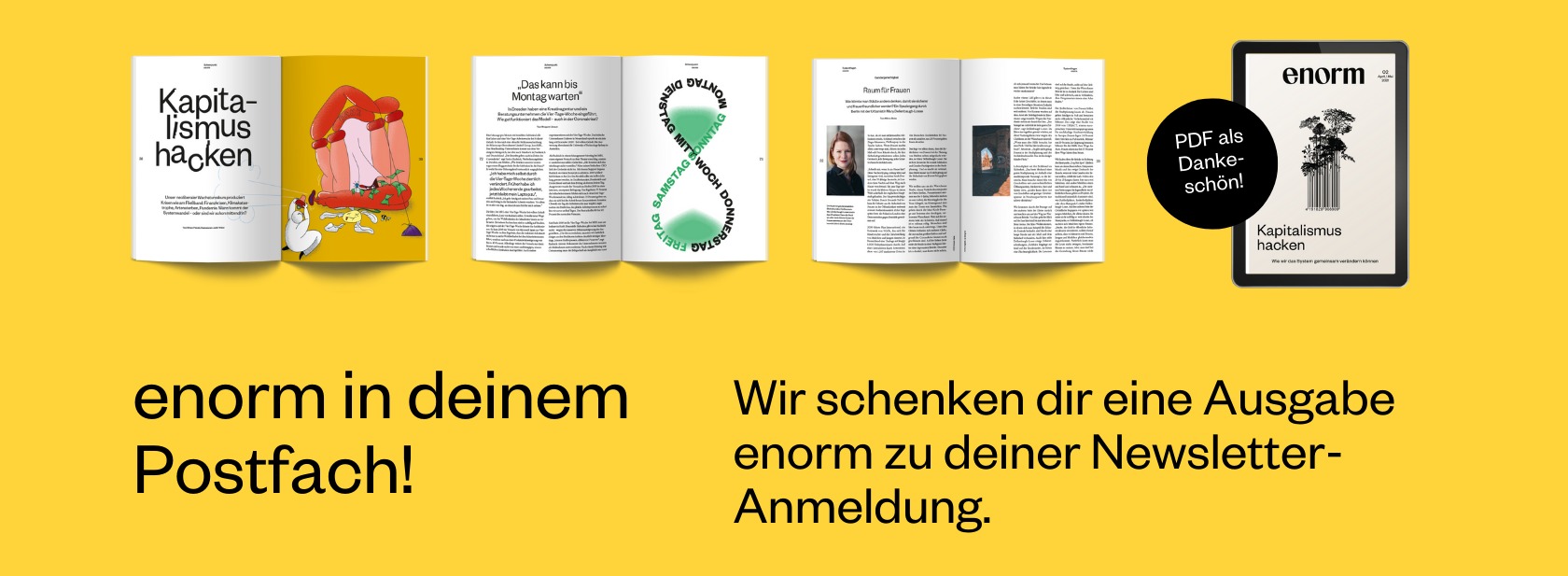Engagement im Studium
An der Uni für die Uni
5 minuten
16 January 2018
)
Titelbild: Mikael Kristenson / Unsplash
Engagement neben dem Studium
5 minuten
16 January 2018
Trillerpfeifen, Transparente, 12.000 Studenten allein in Berlin. Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, erinnert sich gut an die großen Bildungsproteste 2009. Mit Wut im Bauch waren die Studierenden auf die Straße gegangen, um gegen die radikale Verschulung des Studiums, Prüfungsdichte und Stofffülle nach dem Bologna-Prozess zu protestieren.
„Mit Erfolg“, so Meyer auf der Heyde. „Viele Studiengänge wurden daraufhin teilweise wieder entrümpelt.“ Dieser Tage sieht man in Deutschland nur noch vereinzelt Studenten lautstark protestieren. Der Grund liegt für Meyer auf der Heyde an der „immer noch sehr engen Taktung des Studiums“, Zeit für Engagement bliebe wenig.
Dennoch gibt es Studierende, die sich an der Uni für die Uni einsetzen. Etwa um die Wirtschaftswissenschaften zu reformieren oder veganes Essen in der Mensa zu erstreiten. „Das Engagement ist punktueller geworden“, so Meyer von der Heyde, nicht die eine große Bewegung, sondern viele kleine. enorm stellt drei Akteure vor.
Viele Studenten engagieren sich neben ihrem Studium für einen guten Zweck
Als die Mitarbeiter der US-Bank Lehman Brothers am 15. September 2008 ihre Habseligkeiten in Kartons und Plastikwannen durch New York trugen, war Mathis Richtmann als Austauschschüler in Chicago. Das Traditionshaus beantragte nach 158 Jahren Gläubigerschutz, tausende Angestellte musten ihren Tisch räumen. Eine Schockwelle schwappte durchs Land. Wie konnte das passieren? Hatte der damalige US-Finanzminister Henry Paulson nicht wenige Wochen zuvor noch gesagt, dass das Finanzsystem „safe and sound” wäre, sicher und gesund? Richtmann dachte, es läge an seinem Englisch, dass er die Kommentatoren nicht verstand. Doch schnell merkte er: Niemand konnte den Zusammenbruch richtig erklären. Noch weniger die weltweite Finanz- und Währungkrise, die folgte.
„Letzlich war das für mich die Motivation, Volkswirtschaften zu studieren“, so Richtmann. „Verstehen, wie Wirtschaft funktioniert.“ Die Ernüchterung kam schnell. „Egal an welcher Wirtschaftsfakultät man landet, überall erwartet einen in den ersten Semestern derselbe Kanon“, so der 24-Jährige. Mikro- und Makroökonomik, veranschaulicht anhand der immer gleichen mathematischen Modellwelten, die den Status quo bestätigen, anstatt zu hinterfragen. Dass Richtmann sich für die Universität in Göttingen entschied, war erst Zufall, dann Glück.
Kurz nach der Finanzkrise hatte sich dort die Hochschulgruppe „Kritische Wirtschaftswissenschaften“ gegründet. Ziel: methodische und theoretische Vielfalt, um kritisch, kreativ und vor allem eigenständig über Wirtschaft nachdenken zu können. Also neben der gelehrten Neoklassik beispielsweise postkeynesianische, marxistische und feministische Ökonomik. Fünf Jahre ist Richtmann mittlerweile dabei. Am Anfang war es ein „steiniger Weg“. Heute bietet die Gruppe jedes Semester mehrere Veranstaltungen an, für manche Module erhalten Studierende sogar Credit-Points.
Dass es so gut läuft, liegt für Richtmann vor allem daran, dass sie „sehr vorsichtig vorgehen“. Keine offene Konfrontation, keine pauschale Kritik. Sondern höfliches Nachfragen, respektvoller Umgang, Verständnis füreinander. „Etliche Professoren sind ebenfalls unzufrieden, aber zu sehr in institutionellen Zwängen gefangen, sie können kaum vom Lehrplan abweichen.“ Auf den Punkt gebracht möchte Richtmann „eine realitätsnahe Volkswirtschaft“. Obwohl die konventionellen ökonomischen Theorien die Finanzkrise weder vorhersagen noch rückblickend erklären konnten, hat sich das Curriculum nicht geändert. „Das ist irr.“
Schon allein, weil Volkswirtschaftler „Schlüsselpositionen in Politik und Wirtschaft bekleiden und über unser aller Wohl und Wehe entscheiden.“ Zusammen mit dem bundesweiten Netzwerk Plurale Ökonomik haben die Göttinger für das Wintersemester nun das Seminar „Political Economy of Finance – Perceptions 10 Years Afer the Crash“ aufgesetzt. Richtmanns Ziel: „dazu beitragen, dass angehende Volkswirtschaftler kritischer denken.“ Ein Gefühl entwickeln für historische Zusammenhänge und institutionelle Mechanismen. Sich wieder die Ursprünge der Ökonomie bewusst machen. Und die liegen nun mal „in der Moralphilosophie, nicht in der Mathematik.“
Oft sind es persönliche Erlebenisse, die den Wunsch wachsen lassen, aktiv zu werden
Den Moment vor fünf Jahren, als er in der ghanaischen Hauptstadt Akkra auf einer Elektroschrott-Müllhalde stand, hat Philipp Hertling nicht vergessen. Die Ausdünstungen der brennenden Geräte kratzten scharf in seinem Hals, die Augen brannten. Hertling beschloss: Ich muss etwas tun gegen diesen Müll-Wahnsinn auf der Welt, am besten gleich, wenn ich zurück bin, an der Uni.
Heute ist Hertling Lehramtsstudent an der Universität Tübingen und engagiert sich für den Einsatz von Reinigungsmitteln an seiner Hochschule, die nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip hergestellt wurden. Über die Dokumentation „Nie mehr Müll“ war er auf den Ansatz gestoßen. Er beruht auf einem ökoeffektiven Kreislauf, also Produkte von Anfang an so entwickelt, dass sie später als Nährstoff für neue Produkte genutzt werden können.
„Endlich ging es mal um eine positive Lösung, nicht um weniger vom Schlechten – weniger Konsum, weniger Verbrauch“, sagt Hertling. Tun statt unterlassen. Er wurde Mitglied im Verein „Cradle to Cradle“, begeisterte Kommilitonen mit einem kritischen Dokumentarfilmabend zum Thema Müll, diskutierte mit der Umweltkoordinatorin und dem Beirat für Nachhaltige Entwicklung und fand einen Weg, den Ansatz an die Uni zu holen: Wie wäre es, die Reinigungstrupps mit Cradle-to-Cradle-zertifizierten Reinigungsmitteln auszustatten?
Im Sommer 2015 wurden die ersten Mittel getestet. Konsequent umgestellt hat die Hochschule ihre Reiniger zwar bislang nicht. Der Einkauf sieht noch bürokratische Hürden. Hertling: „Mitgestalten braucht eben Durchhaltekraft.“ Das nächste Treffen mit der Verwaltung ist für Anfang des Wintersemesters anberaumt. Nach den Reinigern will Hertling nun auch anregen, die Büroausstattung nach Cradle-to-Cradle auszuwählen. Was sich der 24-Jährige wünscht: „mehr Unterstützung von Kommilitonen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich an der Uni zu engagieren – auch wenn der Studienalltag voll ist.“ Studieren, lernen, Prüfungen schreiben, „klar, wichtig“, aber die Erfahrungen, die man macht, indem man sich einsetzt, recherchiert, diskutiert, organisiert, und auf Menschen zugeht, sind genauso viel wert.
Gemeinsam können wir den Uni-Alltag besser gestalten
Was für ein Aufschrei. Das Hildesheimer Literaturinstitut hat ein „Sexismus-Problem“. So stand es im Sommer in einer anonymen Polemik, die die lokale Studentenzeitung „Faltblatt“ veröffentlichte. Während die Institutsleitung jedes Gespräch in größerer Runde verweigerte, diskutierten die Studierenden, wer wohl dahinter steckt, was denn nun ist und ob man so schreiben darf – so pauschal, so bissig, so wenig konstruktiv.
„Keiner wusste richtig, was Sache ist“, erinnert sich Jana Zimmermann. Wer wirft wem was vor, wer hat zu wem was gesagt, „vieles lief hinter verschlossenen Türen ab“. Als die Zeitschrift Merkur einen Blog über „Sexismus in Hildesheim“ initiierte und auf dem Literaturfestival Prosanova darüber hitzig debattiert wurde, stand für die 24-Jährige fest: „Wir brauchen einen fairen Dialog und Vermittler, die die Erfahrungen und Forderungen der Studierenden bündeln und weitergeben.“ Zusammen mit zwölf anderen gründete sie das Studierendenkollektiv Solo, so hatte sich der bis heute unbekannte Autor des Faltblatt-Artikels genannt.
Erste Amtshandlung: ein nichtöffentliches Google-Dokument, in das Studierende schreiben konnten, was sie am Institut erleben. Die Resonanz war für Zimmermann „krass“. Bislang hatte sie Witzeleien und Anzüglichkeiten als persönliches Problem abgetan. „Jetzt merkte ich, dass Sexismus und Diskriminierung strukturelle Dinge sind, die alle betreffen.“ Fast jeder schrieb zudem darüber, wie seine Hinweise, ein Text sei sexistisch oder man wünsche sich mehr Stücke von Frauen oder nicht Heterosexuellen, als „Genderkram“ abgetan wurden. „Dabei lesen wir fast nur Texte von weißen, europäischen Hetero-Männern“, erzählt Zimmermann. „An einer Uni, die sich damit schmückt, zur Avantgarde Deutschlands zu gehören, muss es drin sein, über diese Themen zu sprechen. Kunst gestaltet und reflektiert Gesellschaft zu einem erheblichen Teil.“
Ein Semester hat Zimmermann noch in Hildesheim, so lange möchte sie mithelfen, „die aufgekratzte Wunde zu verarzten.” Aus dem Google-Dokument hat die Gruppe Forderungen abgeleitet und an Dekanat und Gleichstellungsbüro geschickt. Unter anderem wünschen sich die Studierenden eine bessere Evaluation. Bislang werden Bewertungsbögen am Ende eines Seminars von Dozenten selbst eingesammelt – „keiner erfährt, was drinsteht, es gibt keine Auswertung, keinen öffentlichen Diskurs“. Literaturliste und Besetzung von Stellen sollen diverser werden. Bisher gibt es nur eine Dozentin am Institut. Gesprächsbereitschaft sei da, sagt Zimmermann, „die Fronten haben sich etwas entspannt.“