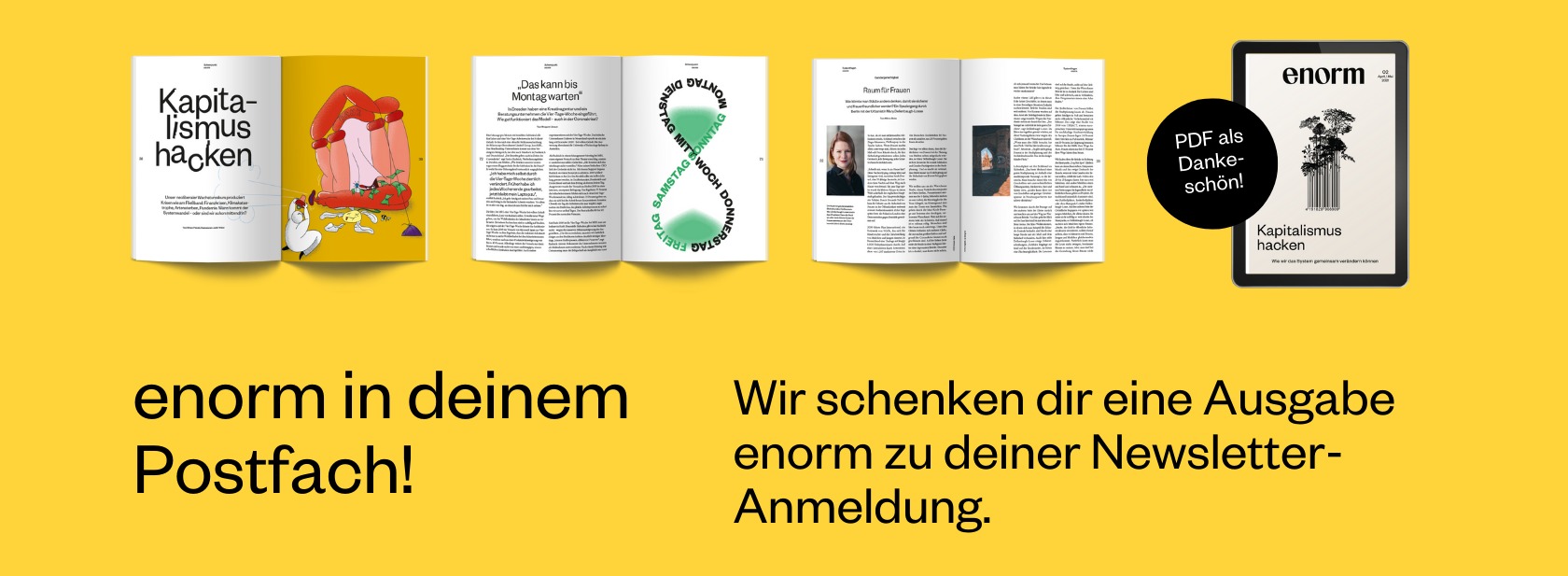Kim Hartzner im Bilanzgespräch
„Ich muss in diese Krisengebiete“
5 minuten
16 July 2018
)
Titelbild: Mission East Deutschland e.V.
Kim Hartzner gibt Thermo-Decken an ein jesidisches Mädchen, die sich alleine um ihre vier Geschwister kümmern muss
5 minuten
16 July 2018
Herr Hartzner, die Flüchtlingskrise hat vor drei Jahren dazu geführt, dass viele Menschen helfen wollen. Was ist besser – spenden oder selber aktiv werden?
Jeder kann natürlich in seiner Nachbarschaft etwas für die Menschen tun, die nach Deutschland geflohen sind. Doch um wirklich einen Unterschied zu machen, muss man mit Not- und Entwicklungshilfe in die Ländern gehen, wo die Probleme entstehen. Dafür braucht es Spenden und hochspezialisierte Experten.
Wenn Sie hundert Euro spenden wollen, würden Sie die dann also eher an eine Hilfs-Organisation im Ausland geben, als an ein Projekt hier in Deutschland?
Absolut. Natürlich ist es verständlich, dass wir dort helfen wollen, wo wir die Not selbst sehen. Doch es kostet uns 195 Mal so viel, einen Flüchtling im Westen zu versorgen, als wenn wir vor Ort Hilfe leisten. Das hat eine Studie des britischen Migrationsforscher Paul Collier vor Kurzem ergeben. Man kann mit dem selben Geld in Krisenländern einfach deutlich mehr Menschen aus der Not helfen. Die Weltgemeinschaft tut hier noch nicht genug. Von den Kriegsopfern im Irak können beispielsweise nur die Hälfte mit Essen, Kleidung und weiterer Nothilfe versorgt werden.
Anstatt nur zu spenden, haben Sie vor rund 27 Jahren mit Ihrem Vater die Entwicklungshilfsorganisation Mission East gegründet. Wie kamen es dazu?
Das war eine spontane Reaktion auf die Not in den ehemaligen Ostblock-Staaten nach dem Mauerfall. Schon seit den späten 60ern hatte mein Vater viel Kontakt zu Menschenrechtlern und verfolgten Minderheiten in mehreren osteuropäischen Ländern und setzte sich für sie ein. 1991 brachten wir Diabetesmedikamente im Wert von umgerechnet 270.000 Euro nach Sankt Petersburg und sahen dort, wie viel wir damit bewirken konnten. Auf dem Rückweg sagte ich zu meinem Vater: „Du reist doch jetzt schon ständig umher, um zu helfen. Du musst nur das, was Du tust, Mission East nennen, und ich werde Dich unterstützen.“ Ich habe dann vier Monate Pause von meiner Tätigkeit als Arzt genommen und bei Firmen nach Spenden von Medikamenten und Hilfsausrüstungen gefragt. Wir wurden von der Spendenbereitschaft total überrollt. Damals haben uns verschiedene dänische Bundesländer ihre Notkrankenhäuser überlassen, die für den Fall eines Atom-Krieges in Kellern gelagert worden waren. Eins davon ist bis heute das Zentralkrankhaus für Kriegsopfer in Armenien. Das war der Anfang von Mission East. Heute haben wir 330 Angestellte und 200 weitere Angestellte in Partnerorganisationen. Aber den Idealismus vom Anfang konnten wir uns erhalten.
Inzwischen sind Sie in neun Ländern tätig – dazu zählen auch Afghanistan, Syrien, Irak und Nordkorea. Wie wählen Sie die Orte aus, an denen Sie helfen?
Wir versuchen dort hinzugehen, wo die Not am größten ist, in Gebiete, in denen Kriege schwelen oder die durch Naturkatastrophen zerstört wurden. Unsere Spezialität ist es, dort irgendwie wieder Ordnung zu schaffen. Wir bauen Wassersysteme auf und versorgen die Menschen mit Hygieneartikeln wie Seife und Wasserreinigungstabletten, wir installieren Latrinen und verteilen Teppiche, Matratzen und Erste-Hilfe-Ausrüstungen. Außerdem haben wir Inklusions-Projekte für behinderte und benachteiligte Menschen, die keinen Zugang zur Gesellschaft haben und wir helfen in ländlichen Regionen neue Lebensgrundlagen aufzubauen – zum Beispiel auch in Afghanistan. Dort helfen wir den Menschen, sich ein neues Leben aufzubauen – etwa indem wir Saatgut verteilen und den Frauen zeigen, wie sie mit Hühnerzucht und Imkerei Geld verdienen können. Eigentlich ist es Frauen dort verboten zu arbeiten. Aber wenn sie durch solche kleinen Tätigkeiten dafür sorgen, dass die Familie mehr Geld hat, haben die Männer nichts dagegen.
In diesen Kriegsgebieten haben Sie sicherlich auch viel Leid gesehen. Hat Sie das nie abgeschreckt?
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss in diese Krisengebiete. Schon als ich als Arzt tätig war, wollte ich immer in Notfallstationen arbeiten, wo ein bisschen Chaos geherrscht hat und die großen Unglücke reinkamen. Man muss sehr schnell reagieren und oft zählt jede Sekunde und jede Entscheidung. Gleichzeitig macht dort die Hilfe den größten Unterschied. Das ist bei der Entwicklungshilfe ähnlich. Es gibt mir eine innere Zufriedenheit, etwas bewegen zu können. Aber es gab auch schon Situationen, die mir zu viel waren und mich total zerstört haben. Zum Beispiel im Irak, wo der Islamische Staat gezielt versucht hat, das Leben von nicht-muslimischen Menschen – zum Beispiel von den Jesiden – zu zerstören. Im Namen ihres total verirrten Glaubens haben sie versucht, alle jesidischen Männer und Jungen umzubringen und die Mädchen und Frauen zu Sexsklavinnen zu machen. Ich habe etwas später mit einem 14-jährigen Mädchen gesprochen, die überlebt hat und sich um allein ihre Geschwister kümmern muss, weil ihre Eltern erschossen wurden. Plötzlich merkte ich, dass ich der Erste war, der mit ihr darüber redet – das war einfach grausam. Zu sehen, wie viel Böses einige Menschen zu tun, in der Lage sind, hat mich zutiefst schockiert.
Die meisten Leute sehen solche Bilder nur im Fernsehen, und vielen wäre es auch lieber, damit gar nicht konfrontiert zu werden. Welche Verantwortung sehen Sie bei den Menschen in den wohlhabenderen Ländern?
Es ist ein großes Risiko, wenn das Leid der anderen bei uns quasi zur Unterhaltung wird. Wer versteht nach einem kurzen Beitrag im heute-Journal über den Irak, dass wir in Europa eine riesige Verantwortung haben in der Welt? Wer wird durch so einen kleine Ausschnitt bewogen, etwas zu tun? Hinzu kommt, dass die Aufmerksamkeit immer sehr kurzfristig ist. Vor einem Jahr hat die ganze Welt über Mossul geredet. Weil damals der IS dort immer noch stark war. Heute gibt es um die Stadt herum circa 800.000 Menschen, die in unfertigen Gebäuden frieren und überleben müssen. Darunter sind rund 500.000 Kinder. Doch von denen hört man überhaupt nichts. So viele Kinder können leiden, ohne dass es jemals ins Fernsehen kommt! Nur weil wir uns nur um dramatische Ereignisse und Feindbilder kümmern. Tatsache ist: Wir tragen alle Verantwortung. Wenn die Menschen in ihrer Heimat keine Perspektive mehr sehen, machen sie sich auf die gefährliche Suche nach einem vermeintlich sicheren und besseren Ort. Doch der Weg nach Europa ist häufig sehr gefährlich. Außerdem sind Hass-Kampagnen gegen Flüchtlinge und feindselige Auseinandersetzungen allgegenwärtig. Wenn wir uns in den wohlhabenderen Ländern mehr engagieren, könnte den Menschen vor Ort noch effektiver geholfen werden, damit sie ihre Heimat erst gar nicht verlassen müssen. Wir tragen alle Verantwortung. Denn wenn wir nichts tun, kommen diese Menschen zu uns und wir erleben noch mehr Hass-Kampagnen und Auseinandersetzungen. Und nicht nur das – die Flüchtlinge müssen vorher ja auch grausame Dinge erleben, um überhaupt hierher zu gelangen.
Wie viel Geld sollte denn jeder für die Entwicklungshilfe geben?
Bei uns in Dänemark wird offenbar für das Silvesterfeuerwerk genauso viel Geld ausgegeben wie alle gemeinnützigen Organisationen des Landes in einem Jahr bekommen. Ich denke, in Deutschland wird das ähnlich sein. Wenn wir also die 40 bis 50 Euro, die wir für Feuerwerk ausgeben, zusätzlich spenden würden, könnten wir die Hilfe schon verdoppeln.
Einige Menschen spenden auch nicht, weil sie das Gefühl haben, dass das Geld in der Verwaltung verschwindet und nicht bei den Kriegsopfern ankommt. Was sagen Sie denen?
Natürlich müssen die Verwaltungskosten gering gehalten werden, aber ohne Verwaltung geht es auch nicht. Wir haben bei Mission East Verwaltungskosten in Höhe von 7,9 Prozent. Das ist sehr gering. Aber ohne die 7,9 Prozent würde gar nichts an die Menschen gelangen. Diese Ausgaben sind die Voraussetzung, dass die 92,1 Prozent bei den Menschen ankommen. Einige Leute haben die Illusion, dass sie direkt an einen Flüchtling hundert Euro überweisen könnten. Aber das funktioniert nicht. Es muss gezielt gearbeitet werden, um sicherzustellen, dass die Spenden auch genau den Ärmsten zu Gute kommen.