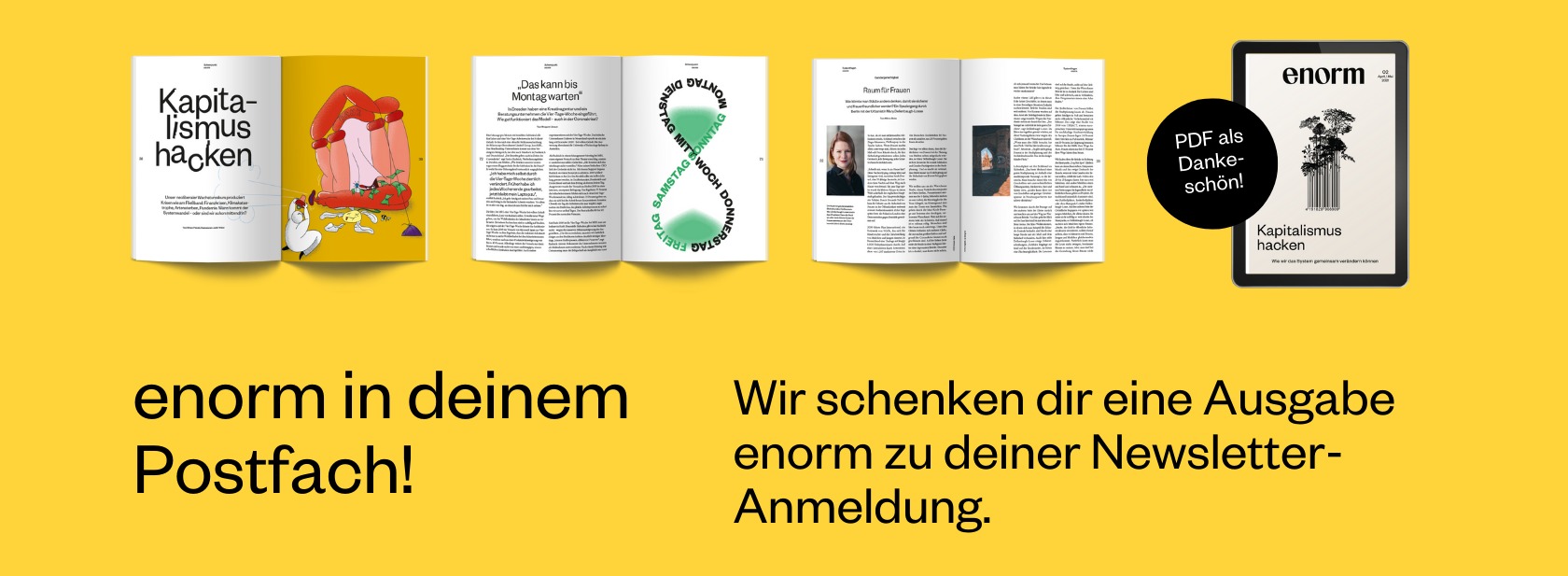Gemeinwohlbilanz
Ein Banker geht aufs Ganze
6 minuten
13 September 2019
)
Titelbild: mauro mora/Unsplash
Eine Gemeinwohlbilanz greift deutlich weiter als herkömmliche CSR-Berichte. Das war auch der Grund für Helmut Lind, diesen Weg auszuprobieren
6 minuten
13 September 2019
Wer vorbildlich sein will, muss sich auch um die Details kümmern. Die Geschirrtücher für die Kantine zum Beispiel. Die kauft die Sparda Bank jetzt bei Blinden- und Behindertenwerken. So steht es auf Seite 18. Eine Seite weiter geht es um die iPhones, ihre Dienst-Handys. Die würden sie gerne austauschen, weil sie nicht fair hergestellt sind. Doch eine passende Alternative haben sie noch nicht gefunden. Dafür hat die Bank, Seite 95, allen Mitarbeitern im letzten Jahr ein anderes Geschenk gemacht: eine Bienenpatenschaft, zusammen mit dem Buch „Makrokosmos Honigbiene“. Und einem Glas Honig.
122 Seiten umfasst der neue Gemeinwohlbericht, er ist deutlich umfangreicher als vor zwei Jahren. Der Aufwand war hoch, höher als bei einem herkömmlichen Nachhaltigkeitsbericht, sagt Helmut Lind, aber jetzt kann man alles nachlesen. Auch die Details. Und natürlich, dass die Bank dieses Mal auf 559 Punkte kommt. Beim letzten Mal waren es noch 385. Von 1000 Punkten, die man insgesamt erreichen kann. Es geht also voran.
Lind ist der Vorstandschef der Sparda Bank München. Er sitzt in seinem lichtdurchfluteten Büro, unter seinen Fenstern rattern ICEs entlang, der Hauptbahnhof liegt nur fünf Fußminuten entfernt. Der 54-Jährige führt die größte genossenschaftliche Bank Bayerns, mit 745 Mitarbeitern, 46 Geschäftsstellen, einer Bilanzsumme von 6,5 Milliarden Euro und mehr als 270 000 Mitgliedern. Es sind wichtige Zahlen, gerade für ihn, daran wird er gemessen. Und doch hält er sie für zweitrangig.
Früher, ja, da hatte er sich selbst auf Rendite und Effizienz getrimmt, die Wirtschaft als Maschine betrachtet. Leistung stand für ihn an oberster Stelle. So hat er, der auf einem Bauernhof aufwuchs und sein Abitur während der Banklehre nachholte, es vor zehn Jahren an die Spitze dieser Bank geschafft. Inzwischen sieht er die Dinge aber anders. „Ganzheitlich“, wie er sagt.
„Das Unternehmen ist ein Organismus, und wie gut der funktioniert, hängt von den Beziehungen der Organe untereinander ab und wie das Blut im Körper fließt.“ Deswegen denke er von den Mitarbeitern her und wie sie ihre Stärken einbringen und sich entwickeln könnten. Und deshalb erstellt er alle zwei Jahre diese Gemeinwohlbilanz, vor ein paar Wochen schon zum dritten Mal. Weil sie tiefer bohrt und fragt, wie es um das Innere des Unternehmens wirklich bestellt sei. Wie fair es also mit Partnerunternehmen umgeht. Wie viel mal mehr der Vorstand im Vergleich zum Angestellten der niedrigsten Tarifgruppe verdient. Wie viele Überstunden die Mitarbeiter machen. Oder eben woher es seine Geschirrtücher bezieht.
Für Helmut Lind genügte kein herkömmlicher Standard
Wenn Unternehmen zeigen wollen, welchen Beitrag sie zur Gesellschaft und zur Umwelt leisten, stehen ihnen zahlreiche Leitfäden und Standards zur Verfügung. Sie heißen EMAS, UN Global Compact, OECD-Leitsätze, Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26000, Deutscher Nachhaltigkeitskodex oder EFQM, und ihre Idee ist, anhand standardisierter Fragen das Wirken der Firmen nachzuweisen. Neu sind sie nicht. Aber ihre Bedeutung wächst gerade.
Ab 2017 müssen alle europäischen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern zusätzlich zu ihrem klassischen Geschäftsbericht einen nicht-finanziellen Bericht veröffentlichen. So will es die EU. Welchen Standard die Firmen wählen, ist ihnen überlassen. Lind hat sie sich alle angesehen, mit Christine Miedl, der Leiterin der Kommunikationsabteilung. Sie befanden alle für ungeeignet. Zu technokratisch, zu oberflächlich. Miedl: „Mich stört, dass viele Unternehmen in ihren Berichten schöne Geschichten erzählen. Aber wenn man Leute aus diesen Unternehmen kennenlernt, dann stellt man fest: Es gibt zwei Unternehmen – das beschriebene und das tatsächliche.“
Also begannen sie vor fünf Jahren, einen anderen Weg einzuschlagen. Dass die Gemeinwohlbilanz auf den Ideen österreichischer Attac-Aktivisten beruht, schreckte Helmut Lind nicht ab. Die in der Bilanz abgefragten Werte – Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung und Transparenz – hielt er auch für sein Unternehmen für relevant. Er hatte zuvor bereits die Währungsspekulationen seiner Bank und die Provisionen für seine Berater abgeschafft.
Dann, drei Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise, wollte er einen Schritt weiter gehen. Lind ist kein Banker, der sich in Nadelstreifen wohlfühlt. An diesem Vormittag in seinem Büro trägt er keine Krawatte, dafür eine helle Hose und mintfarbene Schuhe. Er meditiert und hält Workshops zum Thema Achtsamkeit. 24 Tage hat er sich in diesem Jahr wieder für Mitarbeiterseminare reserviert, mehr als einen Monat. Ungewöhnlich viel für einen Vorstandschef.
Seine Kollegen im Vorstand, im Aufsichtsrat und im Verband der Sparda Banken, in dem die zwölf bundesweit verteilten, unabhängigen Häuser organisiert sind, kennen ihn. Wissen, dass er anders denkt. Und ihre Genossenschaftsbank, 1930 von Eisenbahnern gegründet, hatte selbst schon immer mehr im Blick als den finanziellen Gewinn. Als Lind im Oktober 2011 seine Gemeinwohlbilanz vorstellte, zitierten sie ihn trotzdem zum Gespräch. Sein Vorstoß ging ihnen zu weit. Ihr Vorwurf: Lind gefährde die gemeinsame Marke. Sie befürchteten, durch seine Offenheit selbst ins Visier von Kunden und Journalisten zu geraten. Etwa: Wenn Lind die Gehälter offen legt – warum macht ihr das nicht auch?
Die ersten ziehen nach
Dabei blieb es nicht. Lind wurde beschimpft, bekam Hass-Mails aus den eigenen Reihen. Er spürte, wie die Kollegen von ihm abrückten. „Da wurde mir klar, dass ich das nicht überlebe, wenn es schiefgehen sollte.“ Heißt: dass er seinen Job verliert, wenn das Geschäft leiden sollte. Zwei bis drei Jahre hielt dieser Schwebezustand an, sagt er. „Erst dann wusste ich, dass ich durch bin.“
Heute, sagt er, nach fünf Jahren, gebe es erste Hinweise darauf, dass auch andere Sparda Banken erwägen, eine Gemeinwohlbilanz zu veröffentlichen. Lind würde das begrüßen. Er verweist auf die Vorteile, etwa, dass sich die Arbeit beim Werben um Kunden und Azubis auszahle. Christine Miedl: „Seit zwei Jahren beobachten wir, dass wir zunehmend Neukunden gewinnen, weil wir eine Gemeinwohlbilanz veröffentlichen.“
Äußern will sich im Verband aber keiner dazu. Dabei gibt es inzwischen namhafte Unterstützung aus Brüssel. Der Europäische Wirtschaftsund Sozialausschuss (EWSA) sprach sich im Herbst mit großer Mehrheit dafür aus, das „Gemeinwohl-Ökonomie-Modell sowohl in den europäischen als auch die einzelstaatlichen Rechtsrahmen“ zu integrieren. „Die Gemeinwohl-Ökonomie wird als praxistaugliches Modell erachtet, das europäische Werte stärkt, den sozialen Zusammenhalt festigt und ein verantwortliches Wirtschaftssystem fördert“, heißt es in dem Beschluss.
Und weiter: „Die Gemeinwohl-Ökonomie ist ein Instrument zum Aufbau eines widerstandsfähigen Sozial- und Wirtschaftssystems, das der europäischen Zivilgesellschaft Schutz und Entwicklungsmöglichkeiten bieten kann.“ 144 Mitglieder stimmten dem Antrag zu, 24 stimmten dagegen oder enthielten sich. Der Ausschuss ist kein legislatives Organ, sondern berät die EU lediglich. Trotzdem bleibt die Frage: Sollten alle Unternehmen so werden wie die Sparda Bank München?
Bekannte Probleme der Gemeinwohlbilanz
Franz Josef Radermacher ist da vorsichtig. Der Professor am Institut für Datenbanken und Künstliche Intelligenz der Uni Ulm ist einer der profiliertesten Vertreter einer ökosozialen Marktwirtschaft. Er kennt Helmut Lind gut und hält das EWSA-Votum für einen „bemerkenswerten Entscheid“. Es verdeutliche die „große und nachvollziehbare Unzufriedenheit vieler Akteure mit dem Status quo in der Wirtschaft“.
Gleichwohl müsse man zwischen dem Instrument der Bilanz und der Idee einer Gemeinwohl-Ökonomie unterscheiden, betont er. Letztere weiche nämlich, gemessen an den Publikationen der Vordenker, „von vielen Ideen unserer heutigen Gesellschaftsordnung ab. Und das auch in dem Sinne, dass Gesetzesänderungen nicht ausreichen, um die verfolgten Vorstellungen umzusetzen. Ebenso sind Änderungen auf Verfassungsebene und bei internationalen Verträgen erforderlich.“
Helmut Lind kennt die Probleme des Konzepts. Einige Thesen und Vorstellungen sieht er selbst kritisch und diskutiert diese immer wieder, etwa mit dem Publizisten Christian Felber, dem prominentesten Kopf der Gemeinwohlbewegung. „Zu Beginn hieß es, dass wir die volle Punktzahl nur dann bekommen könnten, wenn wir keine Dividende mehr auszahlen.“ In den letzten Jahren ist die Bank bereits von 5,5 Prozent auf 3 Prozent runtergegangen. Aber keine Dividende?
Auch andere Forderungen zum Thema Einkommen und Vermögen hält er für nicht mehrheitsfähig.„In letzter Konsequenz würden sie bedeuten, dass wir auf einen Sozialismus zusteuern sollten. Alles gehört allen. Das ist mir zu extrem, zu dogmatisch“, sagt er. Andererseits verweist er auf die aktuelle Flüchtlingsdiskussion und auf Städte und Gemeinden, die erwägen, privates Eigentum für ihre Zwecke zu beschlagnahmen und als Flüchtlingsunterkünfte zu verwenden. „Das hätte man sich vorher ja auch nicht vorstellen können. Vielleicht ist die Gemeinwohl-Ökonomie also nicht so weit von der Realität entfernt, wie man glaubt.“
Grundlage für alle Interessierten
Zu Beginn, vor fünf Jahren, waren es 55 Pioniere, die wie Lind eine Gemeinwohlbilanz veröffentlichten. Inzwischen ist die Zahl der Unternehmen laut Aussage der Initiatoren auf etwa 250 angestiegen. Bis heute aber ist die Sparda Bank München die einzige deutsche Bank. Die Berührungsängste scheinen groß zu sein. Deswegen will Lind sich weiter für die Sache einsetzen, auf Veranstaltungen werben, Position beziehen. So wie er es in den letzten Jahren auch gemacht hat.
Dass manch Wirtschaftsethiker dem Gemeinwohl-Vordenker Christian Felber vorwirft, die freie Marktwirtschaft abschaffen und durch ein System ersetzen zu wollen, in dem ein elitärer Zirkel dem Rest der Bevölkerung vorschreibt, wie er zu leben hat, stört ihn nicht. Strittige Thesen werden sich, so seine Hoffnung, in der Praxis regeln. Ohnehin versteht er den Ansatz als Grundlage für alle Interessierten, sich einzubringen. Als Vorlage. Damit das, was als Gemeinwohl bezeichnet wird, tatsächlich gesellschaftlich ausgehandelt wird.
Ob dieser Dialog möglich ist, konstruktiv, über die ideologischen Grenzen hinweg? Das vermag Helmut Lind momentan auch nicht zu sagen. Er wird aber weiter beharrlich daran arbeiten. Vor zwei Monaten hat er seine dritte Gemeinwohlbilanz vorgelegt, die vierte, sagt er, bereite er mit seiner Kollegen Christine Miedl schon vor. Vielleicht wird der Bericht dann nochmal umfangreicher. Manches klappt ja eben noch nicht, das mit den iPhones zum Beispiel. Wenn sie das aber gelöst haben, dann gibt’s noch ein paar Punkte mehr für ihre Bilanz.