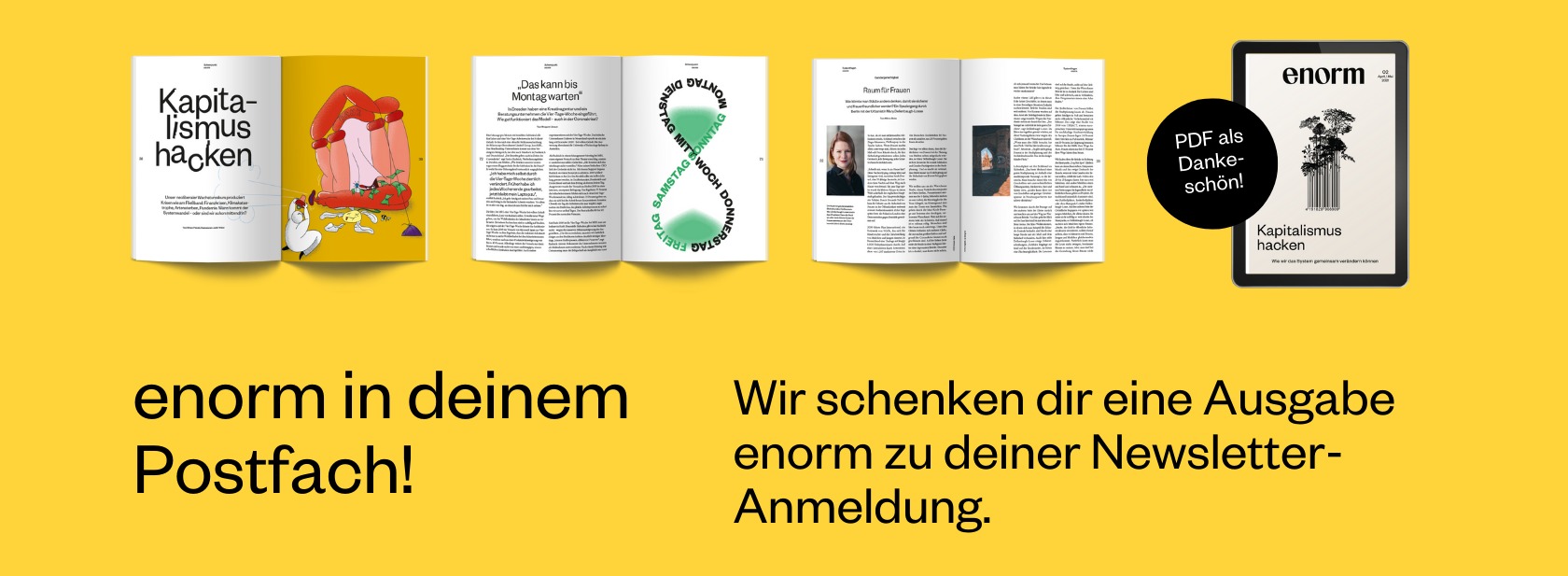4 minuten
23 April 2014
Am Wachstum scheiden sich die Geister. Politiker fordern mehr davon, Ökologen kritisieren es. Den einen gilt es als Garant für Wohlstand, Arbeitsplätze und überhaupt dafür, dass es der Gesellschaft gut geht. Die anderen sehen Wachstum als Problem, das dem Klima schadet, die Menschen zur Konsumsucht verführt und ihrem Leben die Ruhe und das Gleichgewicht nimmt.
Aber was ist Wachstum eigentlich genau? Woraus besteht es? Sprechen Gegner und Befürworter überhaupt über das gleiche? Und gibt es Möglichkeiten zur Versöhnung? Oder ist die Idee vom grünen, nachhaltigen Wachstum in Wirklichkeit eine Illusion und ein Widerspruch in sich?
Tatsächlich hat ein Teil der Konflikte um das Thema Wachstum inzwischen wohl damit zu tun, dass der Begriff zu pauschal gebraucht wird. Begonnen hat die Diskussion 1972. Damals veröffentlichte der Club of Rome unter den Wissenschaftlern Donella und Dennis L. Meadows den Bericht „Die Grenzen des Wachstums“. In verschiedenen Szenarien spielten sie durch, wie lange die Erde Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Rohstoffverbrauch, Unterernährung und die Zerstörung natürlicher Lebensräume noch aushalten würde. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Grenzen des Wachstums 100 Jahre später erreicht sein würden. Es war der erste Bericht dieser Art, die Reaktionen darauf waren gewaltig. In den Folgejahren wurde das Buch in 30 Sprachen übersetzt und mehr als 30 Millionen mal verkauft.
Was bringt Wachstum?
Wenn Politiker wie Angela Merkel heute von Wachstum sprechen, meinen sie vor allem das Wirtschaftswachstum, genauer: das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Um Industrialisierung geht es ihnen dabei weniger, um Bevölkerungswachstum gar nicht. Zwar wünschen sich die meisten Politiker auch eine höhere Geburtenrate. Dabei sind sie jedoch nicht auf unendliches Wachstum aus, sondern nur darauf, dass nicht mehr Alte sterben als Junge geboren werden, damit die Gesellschaft nicht schrumpft und die Sozialsysteme bezahlbar bleiben.
Auch die Zeiten der immer stärkeren Industrialisierung sind vorbei: Heute vollzieht sich ein großer Teil des Wirtschaftswachstum in Branchen, die mit winzigen Teilen (Computer-Hardware) oder fast ganz ohne materielle Ressourcen auskommen (Software). Zwar werden dabei immer noch natürliche Ressourcen verbraucht, bei deren Abbau die Umwelt belastet wird, zum Beispiel seltene Erden. Da in der Vergangenheit aber nicht nur die Wirtschaftsleistung, sondern auch die Effizienz der Technologien gewachsen ist, bedeutet das Wirtschaftswachstum von heute nicht denselben Rohstoff-Verbrauch wie jenes vor 100 Jahren.
Dazu kommt: Wenn Politiker Wachstum fordern, ist das in der Regel kein Selbstzweck. Ihnen geht es meistens vor allem um die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die sie sich mit dem Wachsen der Wirtschaft erhoffen; eines der wichtigsten Themen in jedem Wahlkampf. Auch hier geht es ihnen nicht um exzessives, grenzenloses Wachstum, sondern nur darum, dass jeder Arbeitswillige auch einen Job findet. Paradoxerweise ist allerdings gerade das aufgrund des Wachstums der Produktivität und der steigenden Automatisierung seit den 80er Jahren immer schwieriger geworden ist.
Was genau ist das Problem?
Auch ein Blick in die Biologie zeigt, dass Wachstum seit jeher zur Welt dazu gehört. Pflanzen, Tiere und Menschen wachsen. Wichtig ist nur, dass sie nach angemessener Zeit wieder zu Staub zerfallen. Eben damit tut sich die moderne Wirtschaft immer noch schwer. Allerdings ist selbst exzessives, scheinbar unbegrenztes Wachstum nicht unbedingt ein Problem; und zwar gerade dann nicht, wenn es immaterielle Güter sind, die wachsen. Dass etwa das allgemein zugängliche Wissen auf der Welt durch Computer und das Internet auf ein nie dagewesenes Maß angewachsen ist, wird in Zusammenhang mit Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung von niemandem kritisiert.
Problematisch am Wachstum ist damit vor allem der Verbrauch materieller Ressourcen, und zwar der Verbrauch endlicher Rohstoffe, deren Abbau und Verarbeitung die Umwelt belastet. Wenn alle Menschen auf der Welt so viel einkauften, reisten und Fleisch äßen wie der durchschnittliche Deutsche, dann würde die Erde wohl kollabieren. Irreparable Schäden hat die Menschheit der Natur schon jetzt an vielen Stellen zugefügt. Je mehr Menschen Strom aus Kohle und Atomenergie verbrauchen, Autos mit Benzin- oder Diesel-Antrieb fahren und Fleisch essen (dessen Anbau ein Vielfaches an Ackerfläche benötigt, die eine vegetarische Ernährung bräuchte), desto mehr Schäden kommen dazu. Klimaerwärmung, die Zerstörung von Böden und Lebensräumen, Artensterben, die Verseuchung großer Gebiete durch Radioaktivität – das sind nur ein Paar Probleme, die mit der Wirtschaft des 20. Jahrhunderts entstanden sind und auch im 21. Jahrhundert mit ihr mit wachsen.
Allerdings gibt es eben nicht nur endliche, sondern auch unbegrenzte Ressourcen, so wie Wind, Sonnenlicht oder die Strömung der Gezeiten. Sie aufzubrauchen wird der Mensch wohl nie schaffen. Und genau daran knüpft sich die Hoffnung der Fürsprecher des grünen Wachstums. Ihnen zufolge ist umweltverträgliches Wachstum möglich, wenn die wirtschaftliche Produktion auf der Grundlage erneuerbarer Energien und effizienter Verwertungskreisläufe stattfindet, zum Beispiel nach dem Prinzip Cradle-to-Cradle. Befürworter des grünen Wachstums wie der Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf Fücks, fordern deshalb eine „grüne Revolution“. Der Politikwissenschaftler Martin Jänicke beschreibt es so: „Worum es geht sind radikale Schrumpfungen – „De-Growth“ – bei den ressourcenintensiven Verfahren und Produkten. Und ein radikales Wachstum bei den Umwelt und Ressourcen schonenden Technologien und Dienstleistungen.“
Funktioniert grünes Wachstum?
Allerdings bewirken die Einsparungen durch effiziente Technologien nicht zwangsläufig auch Einsparungen in der Ressourcennutzung insgesamt. Denn was Konsumenten an der einen Stelle durch Ökostrom oder einen reduzierten Fleischkonsum einsparen, pulvern sie nicht selten mit anderen umweltbelastenden Konsumentscheidungen wie Langstreckenflügen oder umfangreichem Fleischkonsum wieder hinaus (besonders wenn es um den Konsum von Rindfleisch geht, bei dessen Erzeugung große Mengen des Treibhausgases Methan freigesetzt werden). Auf solche Rebound-Effekte weisen Kritiker des grünen Wachstums wie der Nachhaltigkeitsforscher Nico Paech immer wieder hin. In einem spekulativen Szenario des Demographie-Experten Reiner Klingholz löst sich dieses Problem dadurch, dass die Weltbevölkerung nach einer Epoche des rasanten Wachstums ab 2050 dadurch langsam wieder zu schrumpfen beginnt.
Was in den grundsätzlichen Debatten um das Wachstum übersehen wird, ist, dass es die entwickelten Volkswirtschaften trotz aller Bemühungen ohnehin kaum noch schaffen, dauerhaft mittlere oder gar große Wachstumsraten zu erzielen. Sowohl deshalb als auch aufgrund der zwiespältigen Ökobilanz des klassischen Wirtschaftswachstums siehe oben) versuchen verschiedene Organisation schon seit einiger Zeit, neue Kennzahlen zu etablieren, die besser als das Bruttoinlandsprodukt in der Lage sind, Fortschritt, Wohlstand und Lebensqualität von Gesellschaften zu messen. Zu ihnen gehören zum Beispiel der Better Life Index der OECD, der Human Development Index der Vereinten Nationen und der Happy-Planet-Index. Auch der deutsche Bundestag hat zu diesem Zweck eine eigene Enquete-Kommission eingerichtet, die im Frühjahr 2013 ihren Schlussbericht vorgelegt hat.
In ihnen wird nicht mehr allein das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts gemessen, sondern auch die Entwicklung von Indikatoren wie Gesundheit, subjektives Wohlbefinden, Luftverschmutzung, Lebenserwartung und viele andere. Damit wird die Debatte erst richtig kompliziert, denn jeder Index erfasst unterschiedliche Faktoren und gewichtet sie in einem eigenen Verhältnis. Andererseits wird die Debatte um das Wachstum so aber auch auf die nächste Stufe gehoben. Denn mit der Diskussion über solche Modelle und die komplexen gesellschaftlichen Zusammenhänge, die ihnen zu Grunde liegen, müssen wir die einzelnen Bestandteile von Wirtschaftswachstum und gesellschaftlicher Entwicklung differenziert betrachten. Damit ebbt zwar das Wachstums selbst nicht ab, womöglich aber der Streit um einen sehr aufgeladenen Begriff.