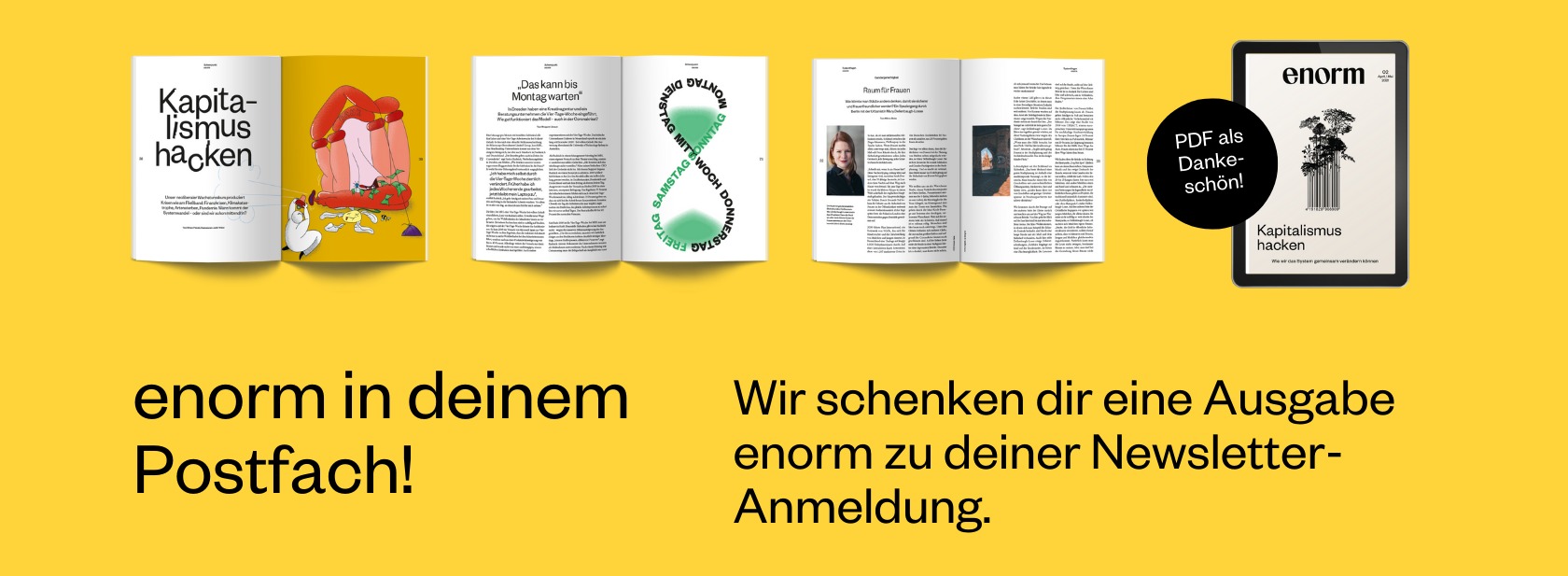7 minuten
20 October 2015
In Stralsund haben sie mal wieder gebaut. Zwölf silberne Tanks sind neben den alten Tanks errichtet worden. In ihnen gärt das Bier. Direkt daneben stehen weiß-blaue Strandkörbe auf einer Düne. Die Düne ist künstlich, die Störtebeker Braumanufaktur hat sie angelegt. Das Ganze wirkt idyllisch, und das soll es auch. Denn das Flair der Ostsee gehört zur Werbebotschaft der Brauerei aus Nordvorpommern, das maritime Flair soll die Absätze ankurbeln. Auf dem Etikett der Flaschen tanzt ein Segelschiff in den Wellen. So wie das Schiff dem Meer trotzt, will die Brauerei dem schwächelnden Biermarkt trotzen. Deswegen hat der Mittelständler gebaut. Wie schon so oft. Das soll Jobs und Profite sichern.
Hunderte Kilometer weiter südlich in der Oberpfalz steht die Brauerei Lammsbräu in Neumarkt. Auch sie muss sich behaupten und mit diesen Deutschen klarkommen, die jetzt mehr Wein trinken. Wachsen will die Traditionsbrauerei nicht unbedingt. Bei Lammsbräu ist man zufrieden mit dem, was ist. Schon knapp 400 Jahre lang. Viel größer will der Familienbetrieb nicht werden, nur die Qualität soll steigen. Blumen wachsen im Innenhof des Betriebs, sie strahlen Landleben aus. Die Etiketten der Bierflaschen ziert ein Lamm, das auf einem Fass Bier liegt. Das Tier sieht gemütlich aus, oder verschlafen. Je nach Blick des Betrachters.
Zwei Brauereien, zwei Weltanschauungen
Ein Schiff auf hoher See, ein dösendes Lamm – die zwei Betriebe aus Nord und Süd trennen Weltanschauungen. Aber beide müssen auf dem schrumpfenden Markt bestehen. Denn die Deutschen – die einst große Biernation – trinken längst nicht mehr so viel Bier. Etwas mehr als 100 Liter pro Kopf wird jedes Jahr konsumiert. In den Siebzigern waren es gut 150 Liter. Die Preise bröckeln, Billigangebote in Supermärkten setzten viele Brauereien unter Druck. Wie überlebt man als kleiner Brauer?
Die Antwort heißt: Nischenbiere und Regionalität. Solche aus der Heimat und solche mit Spezial-Geschmack. Störtebeker etwa bietet Whiskey-Bier an, ein rauchig schmeckendes, dunkles Gebräu. Lammsbräu bedient die Bio-Nische. Das grüne Bier schmeckt fast wie normales Bier. Die Leute kaufen das, obwohl es teurer ist.
Aus Überzeugung wachstumsneutral
Warum wollen die einen zulegen und die anderen nicht? „Wir sind aus Überzeugung wachstumsneutral“, sagt Franz Ehrnsperger, der Inhaber von Lammsbräu. Der 69-Jährige hat Betriebswirtschaft studiert, das Bierbrauen hat er in Freising bei Weihenstephan gelernt. Ganz traditionell. Die Brauerei hat er vom Vater übernommen, das ist mehr als 40 Jahre her. Ehrnsperger ist knapp zwei Meter groß und wirkt zunächst doch unscheinbar. Bis er anfängt, von den Grenzen des Wachstums zu sprechen, davon, wie wichtig regionale Herstellung ist und Öko-Anbau. Dann ist zu sehen, dass er einiges riskiert hat für seine Ideen. Hartnäckig verweigert er sich dem großen Credo der Lebensmittelbranche: mehr und mehr und mehr Absatz. So viel, wie die Leute essen und trinken oder wegschmeißen können. Ehrnsperger will das nicht, nicht um jeden Preis. Wandeln statt wachsen, das ist seine Philosophie.
Wachstum ermöglicht Entwicklungschancen
„Durch das Wachstum können wir uns so entwickeln, wie wir es wollen“, sagt dagegen Konkurrent Jürgen Nordmann in Stralsund. Dem Betriebswirt, 54, gehört die Brauerei. Ursprünglich stammt er aus Wildeshausen bei Oldenburg. Brauen hat er nie gelernt, seine Eltern hatten einen Getränkehandel. Nach der Wende erwarb sein Vater die ostdeutsche Brauerei von der Treuhand. Der Vater habe den Betrieb von den sozialistischen Strukturen befreit, erzählt Nordmann. Vieles ging langsamer als erhofft. Seit ein paar Jahren erst läuft es besser.
Mit seinem Traum von der Stagnation ist Ehrnsperger eher ein Außenseiter. In Deutschland wollen – quer durch alle Branchen – nur ein paar Tausend Unternehmer gezielt auf weiteres Wachstum verzichten. Meist haben diese Betriebe lange gut zugelegt und wollen das auskömmliche Niveau jetzt halten. Fast immer sind es Unternehmer mit eigenem Betrieb, die unabhängig von fremden Geldgebern agieren.
Bio-Qualität seit 30 Jahren
Lammsbräu gehört auch einer unabhängigen Familie. Namentlich erwähnt wurde die Brauerei erstmals 1628. Ehrnsperger hat sie auf ökologische Produktion umgestellt. Anfangs waren Gerste, Hopfen, Hefe und Malz kaum in Bio-Qualität verfügbar. Ehrnsperger musste erst den ökologischen Anbau in der Region fördern, bevor er vor knapp 30 Jahren das erste Bio-Bier abfüllte. Heute sind selbst Aldi und Lidl auf den Biotrend aufgesprungen. Das ahnte der Pionier nicht, für ihn war das riskant.
Doch er hatte Glück, die meisten Kunden zogen mit, sie zahlen gut 20 Prozent mehr für Bio-Qualität. Bis heute arbeitet Ehrnsperger in der Firma, andere in seinem Alter sind längst in Rente. Schritt für Schritt zieht er sich zurück, die Leitung will er erst später an den Sohn, 25, übergeben. Momentan leitet eine familienfremde Managerin die Geschäfte. Die Brauerei teilweise zu verkaufen, sei für ihn nie in Frage gekommen, sagt Ehrnsperger. Die Familie will selbst entscheiden.
Wachstum schafft Jobs und Anerkennung
Der Vater von Jürgen Nordmann hat für die Brauerei einst eine Million D-Mark bezahlt. Das war 1991, kurz nach der Wende. Nordmann Junior hatte gerade sein Studium beendet. Große Westmarken drängten auf den Markt, eingesessene Betriebe hatten es schwer gegen diese Hersteller mit ihren Leuchtreklamen und ihrer Weltläufigkeit. „Für die Einheimischen blieb Stralsunder auf Jahre vorverurteilt und chancenlos, auch als die Qualität besser wurde“, sagt Nordmann. Die Renaissance alter Ostmarken kam erst viel später. Doch Nordmann erhielt Anerkennung für die vielen Jobs, die er in der strukturschwachen Region schaffte. Mehr als zehn Prozent der Menschen in Stralsund sind arbeitslos. Vor drei Jahren hatte die Brauerei noch 78 Angestellte, heute sind es schon 111. Mehr Absatz bringe weitere Jobs, sagt Nordmann. Das ist an der Küste ein Segen, und das sieht auch die Politik so. Insgesamt 50 Millionen Euro sind seit der Wende in die Brauerei geflossen, ein Drittel kam vom Staat.
Bis sich das rentierte, hat es gedauert. Nach der Wende krachte der Absatz von einst 100 000 auf 10 000 Hektoliter Bier ein. Nordmann hatte anfangs nur zwei Großkunden und kaum Spielraum für höhere Preise. Er habe sich aus dieser Abhängigkeit lösen wollen – und das sei nur über Wachstum gegangen. 2011 benannte die Familie die Brauerei in Störtebeker um, so wie der Pirat. Zudem erschloss sie neue Vertriebswege. Die Marke Störtebeker gibt es inzwischen im Handel und auch online. Nordmann hat kräftig in Werbung investiert. Weil er eine Marke schaffen wollte. Weil er will, dass die Käufer die Ostsee riechen und schmecken, wenn sie sein Pils oder Weizen trinken.
Auch Biobrauer Lammsbräu ist gewachsen. Das sei aber nicht das vorrangige Ziel, beteuert der Besitzer. Etwa 76 000 Hektoliter Bier hat die Brauerei mit den 117 Mitarbeitern vergangenes Jahr verkauft. Bei Ehrnspergers Einstieg war es nur knapp die Hälfte. Vieles hat er so gelassen. Das Sudhaus, wo die Würze des Bieres entsteht, besteht seit 1965. Die Mälzerei wurde seit 1955 nicht vergrößert und das Lager im Keller seit mehr als 100 Jahren nicht erweitert. Dafür, dass die Familie „wachstumsneutral“ agieren will, ist der Umsatz beachtlich geklettert. 2012 lagen die Erlöse bei 15,5 Millionen Euro, zwei Jahre später waren es 19,4 Millionen. Ehrnsperger findet das nicht widersprüchlich. Er schaut auf das, was geschrumpft ist: Jahr für Jahr setze der Betrieb weniger Ressourcen ein und verringere den Ausstoß von Schadstoffen, sagt er. Inzwischen sind nur noch fünf Liter Wasser für einen Liter Bier nötig. Bei der Vorgänger-Generation war es sechs Mal so viel.
Selbstauferlegte Begrenzungen
„Wenn wir im klassischen Sinne wachsen wollten, müssten wir es wie andere Brauereien machen und auf die grüne Wiese ziehen“, sagt Ehrnsperger. Doch das Gelände soll nicht erweitert werden, die Wege der Zulieferer sollen kurz bleiben. Es sind die Begrenzungen, die Lammsbräu sich auferlegt hat. Auch die eigene Quelle will die Firma nicht zu stark ausschöpfen. Verkauft wird vorwiegend regional, Lammsbräu liefert nur geringe Mengen ins Ausland.
Nordmann würde wohl liebend gerne mehr ins Ausland liefern. Weil er Nischenbiere anbietet, ist die Zahl der deutschen Käufer begrenzt. Noch macht die Firma den größten Teil des Umsatzes zuhause, doch längst wird das Bier von der Küste per Lkw über die Alpen nach Italien gekarrt. Containerschiffe bringen Störtebeker-Flaschen bis nach Schweden und Norwegen. Nordmann setzt auf die Urlauber. „Die Leute sind in den Ferien hier, trinken unser Bier und wollen es zu Hause auch.“ Das fördert er kräftig. Etwa 12.000 Menschen besuchen die Brauerei pro Jahr und bleiben zur Verkostung. Nordmann verführt die Besucher gern. Er hat Mitarbeiter in Biersommelier-Kurse geschickt und die inszenieren diese Verkostungen jetzt als Event. Es gibt Starkbier zu Schoko-Kuchen und Bernstein -Weizen zu deftigem Käse.
Lammsbräu verzichtet fast gänzlich auf Werbung und Events. Wozu auch. Schließlich soll nicht mehr verkauft werden. Wenn die Nachfrage trotzdem steigt? „Dann gibt es das Bier eben mal nicht“, sagt Ehrnsperger. Kein Lammsbräu im Supermarkt? Ausverkauft? Es sind idealistische Worte, die manchen Unternehmer irritieren dürften. Tatsächlich verzichtet Ehrnsperger auf Größenvorteile, wie sie jeder Fabrikant kennt: Denn wer im großen Stil produziert, kann die Kosten pro Flasche senken und seine eigenen Profite steigern.
Wachstum kann sich lohnen
Beim Rivalen im Norden setzen sie auf solche Vorteile. Mit größeren Anlagen könne man eine bessere Qualität erreichen, erzählt Nordmann. Doch solche Anlagen sind teuer. Sind sie errichtet, müssen sie ausgelastet werden. Damit die Investitionen wieder verdient werden. Etwa 123.000 Hektoliter hat Störtebeker im vergangenen Jahr gebraut. Weit mehr als zu DDR-Zeiten. Mit den neuen Tanks soll sich diese Menge nochmals fast verdoppeln. Es ist ein Rad, das sich dreht und dreht, und das sich für Unternehmer wie Nordmann lohnt: 2013 hat der Betrieb fast eine halbe Million Gewinn gemacht.
Auch bei Lammsbräu investieren sie regelmäßig in Anlagen. Aber als eine von wenigen Brauereien betreibt Lammsbräu eine eigene Mälzerei, hier keimt das Getreide zu Malz. Ehrnsperger macht das, obwohl Herstellen teurer ist als Zukaufen. Denn er traut fremden Betrieben nicht. „Ich glaube nicht, dass aus einer Mälzerei, in der Bio-Getreide zusammen mit konventionellem gemälzt wird, reiner Bio- Malz kommt“, sagt er. Lammsbräu kann sich das leisten, weil die Kunden mitziehen. Sie zahlen fast drei Euro pro Liter. Im Vergleich: Störtebeker-Bier kostet nur 1,50 Euro, also rund die Hälfte.
Wo ist die gute Grenze für eine Brauerei? Wann verliert ein Mittelständler seine Identität? Das könne er nicht sagen, sagt Öko-Unternehmer Ehrnsperger. „Aber wir können gut so bleiben, wie wir sind.“ Nordmann von Störtebeker träumt davon, dass sein Bier bald an vielen fremden Küsten getrunken wird. Im Baltikum, im Pazifik, an der Ostküste der USA. „Überall, wo Wasser ist, funktioniert die Marke Störtebeker, da passt sie ins Lebensgefühl.“ Mit geschicktem Marketing will er dafür sorgen. Störtebeker macht schon heute ein Fünftel vom Umsatz mit Verkostungen durch die eigenen Sommeliers und mit Führungen. Die stillgelegten Räume der alten Ost-Brauerei kann man für Hochzeiten und Firmenfeiern mieten.
Ob die Brauerei jetzt nicht groß genug sei? Unternehmer Nordmann wundert sich über solche Worte. Zweistellig ist seine Brauerei zuletzt gewachsen, das darf gerne so bleiben. „Jetzt ist die schönste Zeit, die wir haben.“ Was denn nach all dem Wachstum noch kommen soll? Nordmann beantwortet das nicht. Er hält das wohl für die falsche Frage.