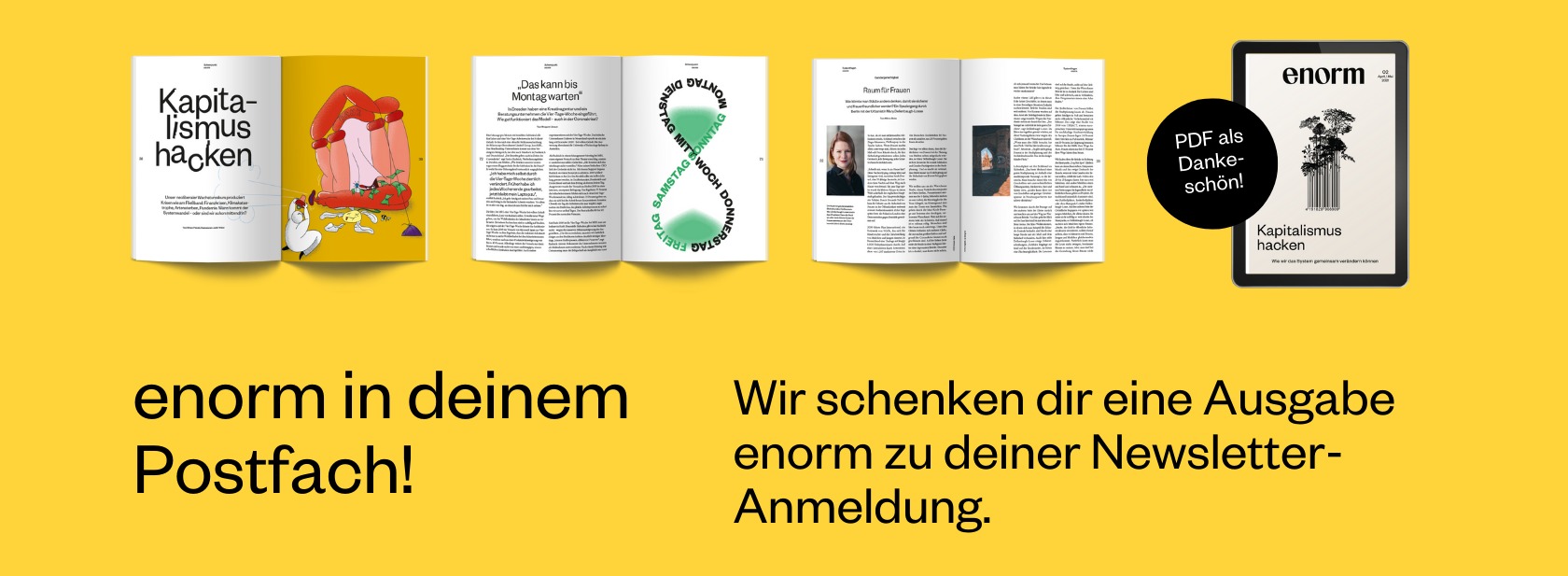Mobilität der Zukunft
Wie viel Auto verträgt die Stadt?
11 minuten
30 December 2016
)
Titelbild: Denys Nevozhai / Unsplash
Die Zukunft der Mobilität wird in den Städten entschieden. Wir stellen vor: zwei Metropolen, zwei unterschiedliche Visionen
11 minuten
30 December 2016
An manchen Tagen ist es wie verhext. Kein Platz, nirgends. Das Parkhaus – besetzt. Die Stellplätze am Bahnhof – alle voll. Und man kann ja nicht einfach den Bürgersteig zustellen und hoffen, dass es niemand sieht. Bei wichtigen Terminen, für die sie ihren Zug nicht verpassen darf, ignoriert Cornelia Dinc die Parkverbotsschilder trotzdem. „Ein, zwei Stunden geht das gut. Aber nach spätestens sechs Stunden wirst du abgeschleppt.“
Neulich saß sie wieder mal im Bus der Genervten zum „Fietsdepot“, dem Sammelplatz für abgeschleppte Räder. 35 Euro später hatte sie ihr heiß geliebtes Fahrrad zurück. Für knapp das Doppelte hätte sie es sich auch via Smartphone-App nach Hause bringen lassen können. „Ärgerlich“, sagt Dinc. Andererseits: „ein Luxusproblem“. Denn dass an manchen Tagen die knapp 5000 Fahrradstellplätze rund um den Bahnhof nicht ausreichen, um alle Räder unterzubringen, bestätigt Dinc in ihrer Mission. Die Fahrradlobbyistin und Bloggerin („Sustainable Amsterdam“) kämpft dafür, ihre Wahlheimat von einer schönen in eine perfekte Radlerstadt zu verwandeln. Und nebenher die ganze Welt. Einfach, weil Radfahren „das beste Mobilitätskonzept für die Lebensqualität der Menschen ist“. Mehr Platz in der Stadt, bessere Luft, entspanntes Tempo. „Ich bin in Calgary in Kanada aufgewachsen“, erklärt Dinc. „Da mussten wir für jeden Einkauf das Auto nehmen. Dass wir in Amsterdam gar nicht mehr wissen, wohin mit den Rädern, ist da eigentlich ein Erfolg.“
Sie erinnern an eine Entenfamilie: vorn die Eltern, ein fetter, silbergrauer Audi Q5 und ein wuchtiger VW Tiguan, dahinter ein Smart und ein niedlicher Fiat 500. Zum dritten Mal rollen die Autos nun schon durch den Eppendorfer Weg. Im Schritttempo wirken die beiden Stadtgeländewagen unfreiwillig komisch. Mit ihrer bulligen Kraft, die ihnen in der komplett zugeparkten Straße so gar nichts nützt. Der Audifahrer kompensiert das ein wenig, indem er gleich nach dem Rechtsabbiegen ein bisschen Gas gibt. Wozu hat man seine 230 PS? Aber ein paar Meter später muss er schon wieder bremsen. Ein Radfahrer mit Leuchtjacke wagt sich zwischen parkenden Autos auf die Straße. Alle Auffahrten sind zugestellt. Einen Radweg gibt es nicht. Der Audi zischt knapp am Radler vorbei. Auch der Tiguan schnaubt unwillig. Erst der Fiat lässt ihn mit auf die Bahn.
Eine Stunde Zuschauen in Hamburgs teurem Altbauviertel Eppendorf und man glaubt wieder an Klischees. Dabei ist es eigentlich egal, wo man zusieht. Ob im Schanzenviertel, in Winterhude, Ottensen oder Uhlenhorst. Spätestens ab 18 Uhr tobt hier der Straßenkampf um jeden Meter. Über die Hälfte aller Wagen, die um diese Zeit durch die Stadt stottern, sind gerade auf Parkplatzsuche, ergaben Studien. Dass die Wagen immer größer und dicker werden, erleichtert die Sache nicht gerade. Der erste Golf zum Beispiel, Baujahr 1974, 3,70 Meter lang, wog 750 Kilogramm. Heute bringt er es auf 1,2 Tonnen und 4,34 Meter. Ganz zu schweigen davon, dass heute ohnehin Geländewagenund SUV-Modelle die Verkaufsschlager sind. Als würde man ständig zunehmen und trotzdem immer engere Hosen shoppen.
Mobilität in den Städten hat erst einmal viel mit Immobilität zu tun. Autos sind wahre Flächenfresser und stehen im Schnitt 23 Stunden pro Tag nur herum. Im „Verteilungskampf um die Räume zwischen den Häusern“, wie das Martin Bill von den Hamburger Grünen nennt, ringen Fußgänger, Radler, PKW, Busse, Taxen, Transporter und LKW miteinander. Da in der Welt von morgen immer mehr Menschen in urbanen Zonen wohnen und arbeiten, entscheidet die städtische Mobilitätspolitik auch über unsere zukünftige Lebensqualität. Werden wir am Immer-Mehr der Autos, Menschen und Bauten kollabieren? Rollen wir in einigen Jahren durch ergrünte Fahrradstädte, in friedlicher Gemeinschaft mit knuffigen selbstfahrenden Autos, die allen zur Verfügung stehen? Leben wir in einer vollständig vernetzten Stadtlandschaft, in der uns sämtliche Mobilitätsangebote mit einem Wisch auf unseren Smartphones zur Verfügung stehen? Oder kommt nur ein diffuses Dazwischen, in dem wir auch in zehn Jahren noch verzweifelt nach Parkplätzen und freien Strecken für unsere Räder suchen?
Zwei Städte als Zukunftslaboratorien
Wie wir uns in den Städten von morgen bewegen werden – und ob überhaupt – hängt von vier großen Fragen ab: Wie verteilen wir den „Raum zwischen den Häusern“? Wie regeln wir den Wirtschaftsverkehr? Welche Verkehrsmittel nutzen wir selbst? Und wie vernetzen wir diese mit der Mobilität der Stadt?
enorm hat sich angesehen, wie Hamburg und Amsterdam diesen Herausforderungen begegnen: Zwei beliebte Hafenstädte, die jährlich Millionen Touristen anziehen; zwei wachsende Wirtschaftsmetropolen, die gewaltige Verkehrsströme organisieren und ihre Luft verbessern müssen. Beide Städte fungieren dabei als Laboratorien unserer mobilen Zukunft. Amsterdam als innovative „Smart City“, regelmäßig zur besten Fahrradstadt der Welt gekürt. Hamburg als größte Industriestadt der Republik und als europäisches Logistikzentrum, das 2021 Gastgeber des „Intelligent Transport System“-Weltkongresses werden will. Als deutsche Großstadt, die zur Nummer 1 beim Radverkehrsanteil werden will, als Vorzeigestadt für einen digital perfekt vernetzten öffentlichen Nahverkehr, der Busse, U- und S-Bahnen mit Carsharing und Leihfahrradsystem kombiniert.
Zwei Metropolen, eine Frage: Wie viel Auto verträgt die Stadt?
„Hamburg ist nicht Amsterdam.“ Andreas Rieckhof, als Staatsrat für Verkehr oberster Hamburger Beamter, wenn es um Mobilität geht, wird diesen Satz fünf Mal in 48 Minuten sagen und jedes Mal ein bisschen weniger freundlich klingen. Zwar hat sich Hamburg das Ziel gesteckt, in den kommenden Jahren zur „Fahrradstadt“ zu avancieren, mit 14 schnellen „Velorouten“ und einem Radfahranteil von 25 Prozent. Aber das heißt nicht, dass der Sozialdemokrat seine Stadt den Ökohippies ausliefern will. „Wir gucken uns Straße für Straße an und dann schauen wir, wie wir sowohl den Belangen des Autoverkehrs, des öffentlichen Nahverkehrs und eben auch des Radverkehrs entsprechen können. Das machen wir peu à peu.“
Rieckhof hat Papierstapel vor sich aufgetürmt. Fakten und Zahlen dazu, was Hamburg zu einer so ganz anderen Stadt macht als Amsterdam. In diesem „zentralen deutschen Logistik-Hub“, dem „Eisenbahnhafen Europas“ rattern täglich allein durch die zentrumsnahe Jüthornstrasse 1600 LKW. Schwertransporter kämpfen sich aus dem Hafen über die nahe Reeperbahn. 330 000 Pendler fahren regelmäßig aus dem Umland in die Stadt und aus ihr heraus. Dazu kommen Lieferwagen, die Supermärkte versorgen, Transporter, die Pakete austragen, Taxen, Linienbusse, und alles wird wachsen, wachsen, wachsen. „30 Prozent mehr Güterverkehr bis Mitte, Ende der 2020er-Jahre“, rechnet Rieckhof vor. Vom 8. Stock des schmucklosen Behördenbaus nahe dem Hamburger Großneumarkt sehen Fahrräder auf einmal ziemlich winzig aus.
Beim Thema Radfahren ist Staatsrat Rieckhof Dr. Diesel und Mister Bike
„Wir sind nicht Amsterdam“, betont Andreas Rieckhof noch einmal und zählt Projekte auf: Teststrecken für selbstfahrende Laster von VW, digitale Vernetzung von Straßen und Fahrzeugen, eine Carsharing-Studie mit BMW, diverse elektromobile Logistikund Transportkonzepte vom Roboterpaketdienst bis zum Elektrobus für den Personennahverkehr, der ab 2020 die Benzinerflotte allmählich ersetzen soll. Vollautomatische U-Bahnen mit neuen Strecken, demnächst über 200 Stadtradstationen für das erfolgreichste Fahrradverleihsystem der Welt, 12 000 neue Radparkplätze an den S- und U-Bahnen der Stadt. Aber, nicht übermütig werden: „Für mich ist das Fahrrad ein praktisches Gerät, ohne Ideologie. Wir müssen den Radverkehr attraktiver machen. Aber es gibt keinen Zwang und es wird keine aktive Politik, jedenfalls nicht aus dieser Behörde, geben, Autofahrer zu vergrämen.“
Beim Thema Radfahren ist Staatsrat Rieckhof Dr. Diesel und Mister Bike. Den Führerschein machte er erst mit 40. Vorher erledigte der Hamburger alles mit Rad, Bus und Bahn. Und, was man kaum für möglich halten würde, wenn man ihn so gegen jedes Fahrverbot für Dieselautos streiten hört, Andreas Rieckhof ist Mitglied einer geschlossenen Facebook-Gruppe, den „Alltagsradlern“. Deren Mantra lautet: „Das Fahrrad ist Selbstverständnis und Philosophie, Transportmittel, Sportgerät, Funobjekt und nicht selten auch Objekt unserer Begierde!“ 8 Kilometer verbesserte Fahrradwege spendierte der Senat 2011, 14 ein Jahr später. Inzwischen kommt man auf knapp 24. Das könnte man auch einen sehr, sehr behutsamen Ausbau nennen: „Natürlich muss sich die Welt ändern“, erklärt Rieckhof. „Aber die Leute müssen das Gefühl haben, dass es mit ihnen gemeinsam oder für sie erträglich funktioniert.“
Wüste Beschimpfungen für Politiker
Wenn Jens Kerstan, der grüne Umweltsenator, aus seinem Bürofenster im 12. Stock schaut, braucht er viel Fantasie, um sich eine ökofreundlichere Hansestadt vorzustellen. Draußen raucht und dampft es geradezu malerisch – das Kohlekraftwerk Moorburg, die Hafenanlagen, viel Industrie. Seit 2015 ist Kerstan im Amt und übernahm damit die Zuständigkeit für den Luftreinhalteplan, den Hamburg auf Druck der Justiz vorlegen muss, weil Schadstoffgrenzwerte der EU-Kommission regelmäßig verletzt werden.
Seit 2010 wartet die Öffentlichkeit auf seinen Plan und es wird wohl auch noch ein bisschen dauern. „Das Gericht hat uns aufgetragen, nicht nur Maßnahmen zu ergreifen, sondern auch zu berechnen, welchen Effekt sie haben. Wir sind jetzt gerade dabei, Verkehrsdaten zu ermitteln, weil wir als Behörde einen Luftreinhalteplan aufstellen müssen, der sicherstellt, dass wir die Grenzwerte einhalten.“ Als oberster Luftreinhalter macht sich Kerstan Gedanken über den Verkehrsmix der Zukunft. „Meine persönliche Wunschvorstellung wäre, dass der motorisierte Personenverkehr abnimmt und dass größere Teile der inneren Stadt langfristig autofrei sind. Dafür gibt es aber momentan in der Stadt und in der Politik noch nicht genügend Akzeptanz.“
Das ist höflich ausgedrückt. Sowohl Kerstan als auch Staatsrat Rieckhof erhalten wüste Beschimpfungen per Brief, Mail oder in sozialen Netzwerken, wann immer auch nur ein Quadratmeter Parkfläche verloren geht. Der Gelegenheitsautofahrer Kerstan hofft aber auf den berühmten steten Tropfen, wenn „Plätze wieder für das städtische Leben nutzbar werden“.
Bis 2025 soll der gesamte Transportverkehr in Amsterdam emissionsfrei sein
2010, als die neuen Grenzwerte der EU-Kommission verkündet wurden, setzte sich in Hamburg ein Verwaltungskraftakt in Superzeitlupe in Gang. In Amsterdam machte man sich direkt ans Werk. Bart Vertelman arbeitet seit 2010 als Projektmanager bei „Amsterdam Electric“. Bis 2025 soll der gesamte Transportverkehr der Stadt, sollen Busse, Taxen, Dienstleistungsfahrzeuge und der Großteil des privaten Verkehrs emissionsfrei fahren.
„Die schärferen Grenzwerte für Luftverschmutzung lassen uns keine andere Wahl. Wir müssen die Elektromobilität so attraktiv machen wie möglich, sonst werden wir unsere Ziele nicht erreichen.“ Er hat eine 32 Seiten umfassende Zwischenbilanz mitgebracht, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden soll. 2010 Ladestationen für Elektroautos stehen aktuell bereit. Zehnmal so viele wie in Hamburg. Bis 2018 kommen noch einmal 2000 dazu. Jedem Bürger, der ein E-Auto fährt, aber in Wohnungsnähe keine Ladestation findet, stellt die Stadt binnen weniger Wochen eine in seine Straße; bezahlen muss er nur den Strom. Mit den Taxiunternehmen hat man sich geeinigt, dass diese bis 2025 nur noch elektrisch fahren.
Bereits heute dürfen die lukrativen Touren vom Flughafen Schiphol nur von Elektrotaxis geleistet werden. Ein ausgeklügeltes Konzept verbindet das Stromnetz so mit den Ladestationen, dass Elektromobile zukünftig als rollende Energiespeicher zur Verfügung stehen könnten. Vor fünf Jahren habe es bei Unternehmern, Taxi- und Logistikfirmen noch „einigen Widerstand“ gegen die ganzen Pläne gegeben, erzählt Vertelman. „Wir haben uns immer wieder zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, wie wir das alles schaffen können. Heute wissen unsere Partner, das ist die Zukunft und sie sind ganz vorn mit dabei.“
2016 wurde Amsterdam von der EU-Kommission zur „europäischen Innovationshauptstadt“ gekürt
2016 wurde Amsterdam von der EU-Kommission zur „europäischen Innovationshauptstadt“ gekürt. Wenn man durch die Hogeschool van Amsterdam spaziert, ahnt man, warum. Die ganze Universität scheint interdisziplinär angelegt, diverse „Meeting points“ und freundliche Cafés laden zum erfinderischen Austausch. Vor der Mensa, direkt neben einer grün bepflanzten Wand, auf der das Wort „Techniek“ leuchtet, wartet schon Susanne Balm darauf zu erklären, wie man in einer Verbindung aus Low-Tech, Design und vernetzter Intelligenz die Logistik einer Großstadt revolutionieren könnte. Balm organisiert ein Forschungsprojekt, „LEVVLOGIC“, zur Verwendung von speziellen Lastenfahrrädern und elektrischen Minivehikeln beim Warentransport.
„Bis zu 30 Prozent aller Transportfahrten könnten auf Bikes und kleine E-Mobile umgestellt werden“, vermutet sie. Die großen Laster müssten nur noch bis zum Stadtrand fahren, dann würden die Minis übernehmen, die in den urbanen Zonen wesentlich schneller und effizienter liefern könnten. Dafür recherchieren Balm und ihre Mitstreiter in Amsterdam, Rotterdam und einigen kleineren Städten. Über 30 Partner von Kurierdiensten, der Post, Fahrzeugbauern, IT-Start-ups bis zu den Gemeinden sind mit an Bord. Am Ende stehen, hofft Balm, „neue Businessmodelle und Anreize für Unternehmen, entsprechende Fahrzeuge in größerer Zahl zu produzieren.“
Sie zeigt Fotos von futuristisch anmutenden Fahrrädern, die erstaunliche Lasten transportieren können sowie kleinen Roboterfahrzeugen, die einem die Pakete direkt nach Hause bringen. Sie selbst lebt autofrei. Nicht aus ideologischen Gründen, sondern „weil ich einfach keines brauche“. Ihre persönliche Flotte aus drei Fahrrädern ist inzwischen wieder auf eines geschrumpft. Im Sommer war sie mal in Berlin, „tolle Stadt“, nur das Radfahren war dort sehr ungewohnt. „Ich musste plötzlich überall höllisch aufpassen.“ So aggressiv wie in Berlin wären die Autofahrer in Amsterdam eher nicht. „Die fahren ja selber alle lieber Rad. Die wissen, wie das ist.“
Amsterdam wollte Grachten zubetonieren
Doch auch Amsterdam war nicht immer die Fahrradstadt von heute. Ganz wie in Hamburg träumte man auch hier in den 60erund frühen 70er-Jahren von der „autogerechten Stadt“, wollte für den wachsenden PKW- und Lastverkehr tiefe Schneisen in das idyllische Stadtbild schlagen. Man überlegte sogar, für die Autos einige der Grachten zu betonieren. Cornelia Dinc hat Amsterdam in ihrer Masterarbeit als „Fallstudie“ einer Stadtentwicklung beschrieben, die auf der Suche nach intelligenten Lösungen für morgen auch mal in der Vergangenheit vorbeischaut. In einem Biergarten breitet sie Fotos aus, die ausgesuchte Amsterdamer Straßen und Plätze zeigen – heute, in den frühen 80ern und vor knapp hundert Jahren. Dass die Bilder von heute den alten frappierend ähneln, macht sie nicht unmodern. „Es ging darum, die Stadt wieder den Menschen zurückzugeben. Das Auto ist für die Stadt einfach nicht geschaffen. Es steht beinahe die ganze Zeit herum, frisst Platz, verpestet die Luft und fährt zu schnell.“ Heute orientiert sich die Stadtplanung daran, Verkehrswege so zu bauen, dass man mit dem Fahrrad überall direkt hinkommt, mit dem Auto aber nicht.
In den 70er-Jahren begannen in Amsterdam und anderen niederländischen Städten Proteste und Demos gegen das Kindersterben auf den Straßen. Tödliche Unfälle, schlechte Luft – ein Teil der Bürger hatte die Nase voll. Ein anderer nicht. Allmählich begann man in einigen Vierteln, die Radwege wieder auszubauen. 1992 entschied Amsterdam in einer knappen Volksabstimmung, zukünftig konsequent aufs Fahrrad zu setzen, Parkplätze abzubauen und die Straßen nach und nach umzugestalten. Damals wurden in der Stadt noch weit mehr Wege mit dem Auto absolviert als mit dem Rad. „Unmöglich!“, protestierten Tourismusbehörde und Handelskammer vor der Abstimmung. „Jährlich kommen 5,5 Millionen Besucher nach Amsterdam, der Großteil von ihnen mit dem Auto.“ Heute liegt der Radfahranteil am Stadtverkehr bei 60 Prozent – und 2015 kamen 12 Millionen Touristen.
Besonders stolz ist Cornelia Dinc auf Anna Luten, die erste „Fahrradbürgermeisterin“ der Welt. Luten soll zwischen den Belangen der RadfahrerInnen, denen der Stadtverwaltung, von Geschäftsleuten, Wirtschaftsunternehmen und anderen gesellschaftlichen Gruppen vermitteln. „Brücken bauen“, nennt das Dinc und hofft, andere Städte zur Wahl eines solchen Bürgermeisters zu animieren. Dabei sind Autos für Dinc kein Feindbild. „Ich denke nicht, dass wir Autos prinzipiell loswerden müssen. In Amsterdam macht das Fahrradfahren nur viel mehr Spaß.“
Ob es wohl Spaß machen wird, wenn Dennis Thering und Martin Bill mal gemeinsam aufs Rad steigen und sich gegenseitig zeigen, was alles besser werden könnte in ihrer Heimatstadt? Entsprechende Einladungen liegen vor. Die beiden Jungpolitiker sind ungefähr gleich alt und als Bürgerschaftsabgeordnete in ihren Fraktionen für den Bereich Verkehr zuständig. Der eine, Bill, hält die grüne Fahne hoch, der andere spricht für die CDU.
Fahrradstreifen auf der Fahrbahn – das ist exakt der Verteilungskampf, der die Hamburger Debatte prägt
In seinen Reden wütet Thering gern, dass „alles getan werde, um den Autoverkehr lahmzulegen“. Er geißelt die „Parkplatzvernichtung“ („317 Plätze weniger im Jahr 2015!“) und den „Abzock-Wahn“ – also das Eintreiben von Strafgebühren für Falschparker. Man wundert sich beinahe, dass vor der „Pflegen + Wohnen GmbH“, für die er arbeitet, nicht demonstrativ ein fetter SUV auf dem Bürgersteig parkt. Nein, Thering ist mit der U-Bahn da und fährt ausgesprochen gern Fahrrad. Den Golf Kombi hat er, weil er mit seiner Familie nun mal ein Auto bräuchte. Stolz verweist Thering darauf, dass die CDU als erste Hamburger Partei ein Radverkehrskonzept vorgelegt und 2009 das Stadtrad ins Leben gerufen habe. Nur: „Aus unserer Sicht hat ein Radfahrer auf einer Hauptverkehrsstraße nichts verloren.“
Fahrradstreifen auf der Fahrbahn – das ist exakt der Verteilungskampf, der die Hamburger Debatte prägt. Wie konsequent darf man Autofahrern etwas wegnehmen? Sollten Radler und Autos den Kampf um den Raum direkt auf der Straße austragen müssen? Thering zitiert den „40-Tonner“, der neben einem radfahrenden Schulkind vorbeisaust, das sich mühsam auf dem Fahrradstreifen hält. Als wäre nicht die eigentliche Frage, was 40-Tonner dort zu suchen haben, wo Schulkinder fahren.
Und doch, zwischen der gefühlt unausweichlichen Verkehrswende und dem realen Verhalten der Hamburger klaffen Welten. „Im Vergleich zu 2010 haben wir über 43 000 Autos mehr auf Hamburgs Straßen.“ 761 655 sind es insgesamt, davon gerade mal 2264 Hybrid- und 673 Elektrofahrzeuge. Selbst CDU-Mann Dennis Thering sagt: „Ich bin dankbar für jeden Verkehrsteilnehmer, der das Auto stehen lässt und auf Bus, Bahn oder Fahrrad umsteigt. Wenn man es hinbekommt, die Zahl der Autos zu reduzieren, dann ist das gut. Dafür muss man die Leute aber überzeugen und ihnen ein günstigeres, schnelleres, komfortableres Angebot machen.“
Vielleicht fehlt in Hamburg einfach ein klar formuliertes, positives Leitbild, wo die Stadt eigentlich hinmöchte mit ihrem Verkehr. Vielleicht sind die alten Schlachten ja längst gewonnen und niemand hat es richtig gemerkt. Als jüngst in der Bürgerschaft über den Ausbau des Radwegenetzes beraten wurde, stimmte am Ende sogar die CDU dafür. „Das hat mich schon überrascht“, sagt Martin Bill, Rechtsanwalt, und einer der grünen „Verkehrsideologen“, die so gern beschimpft werden. In der Zukunft, die Bill sich erträumt, fahren deutlich weniger Autos, aber dafür öfter („Fahr- statt Stehzeug“), und statt festen Fahrplänen wird der Busverkehr variabel und direkt via Nachfrage auf dem Smartphone organisiert wie öffentliche Sammeltaxis.
Dabei setzt er weniger auf die große Revolution, eine Kampagne „Autofrei!“ womöglich, sondern auf die normative Kraft des Faktischen. „Wir wollen, dass bei der Überarbeitung der Infrastruktur die Räume gerechter verteilt werden. Dass die Autos in dem begrenzten Raum einer Stadt danach weniger Platz haben, ist ja klar. Aber wir sagen jetzt nicht, wir wollen Euch das Autofahren verbieten.“ Das sagt man heute in Hamburg auch als Grüner nicht mehr. „Die Innenstadt wird sich in den nächsten Jahren extrem verändern. Das werden wir aber nicht verordnen, sondern das wird sich entwickeln.“
Die Vision: mehr Platz zum Flanieren
Das Beispiel Amsterdam zeigt, dass sich Richtungen bei der Entwicklung einer Stadt auch ändern können. Hamburg ist ein besonders schwerer Tanker, planerisch und habituell noch immer dem Konzept einer autogerechten Stadt verhaftet, zumindest passiv. Denn betrachtet man die vielen wunderschönen Straßen der Gründerzeitviertel, die Alsterwege, den Platz vor den Museen und Galerien der Kunstmeile, dann mag man kaum noch nachvollziehen, wie diese urbanen Schönheiten zu wüsten Parkplatz- und Schnellstraßenflächen degradiert werden konnten.
Für Martin Bill ist der berühmte Ballindamm an der Binnenalster („so etwas wie die gute Stube von Hamburg“) einer der Orte, die hoffentlich spätestens seine kleine Tochter einmal wieder in seiner wirklichen Pracht erleben darf. „Vier Autospuren, aber die ganzen Fußgänger quetschen sich auf maximal zwei Meter Platz. Ich wünsche mir, dass nicht nur der Radweg breit wird, sondern auch der Fußweg, dass man dort die Mittagspause genießen und sich abends noch mal in die Sonne setzen kann.“
Wenn man dann dort überhaupt noch einen Parkplatz findet. Für sein Rad.