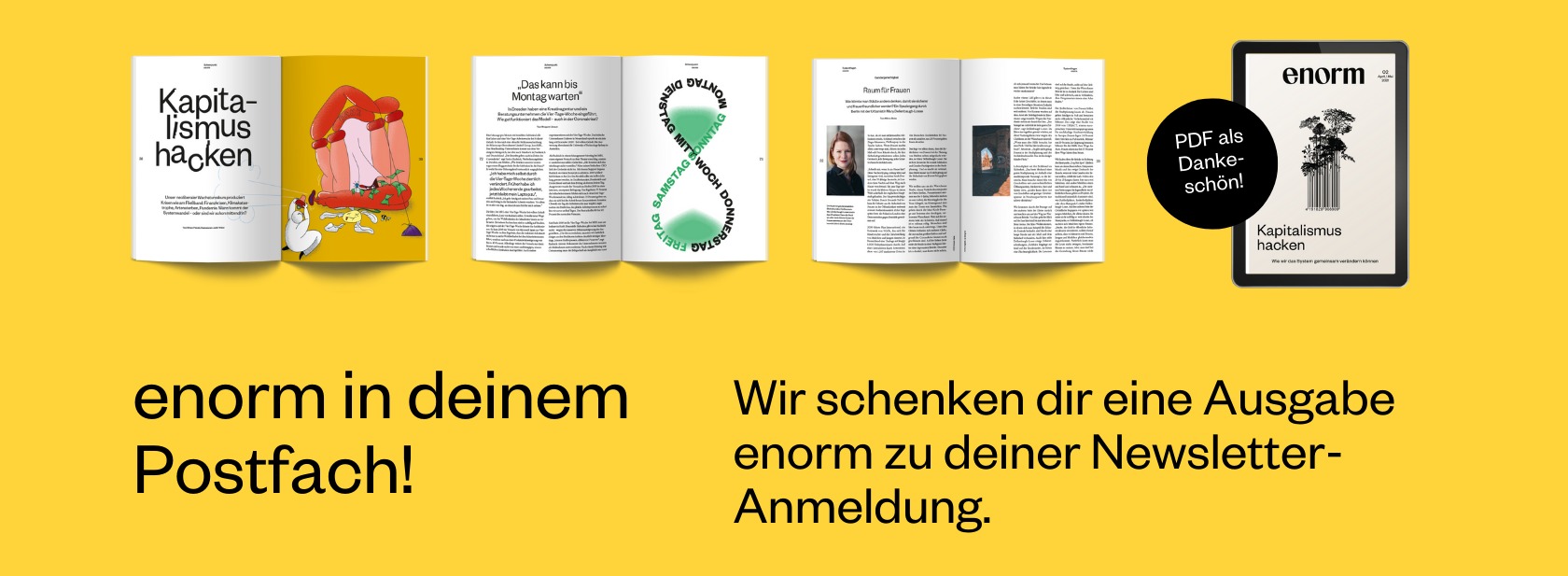Ökodiktatur vs. Demokratie
Im Namen der Zukunft
6 minuten
4 July 2014
)
Titelbild: arindambanerjee / Shutterstock
Demonstranten und Polizisten beim G20-Gipfel 2010 in Toronto: Wie kann die Politik dazu gebracht werden, vernünftige, nachhaltige Entscheidungen zu treffen?
6 minuten
4 July 2014
Herr Gesang, der Weltklimarat hat kürzlich wieder eindringlich vor den Folgen des Klimawandels gewarnt. Die westliche Politik ist aber weiter wie gelähmt – Entscheidungen fallen, wenn überhaupt, spät und zögerlich. Brauchen wir ein anderes politisches System?
Nein. Nichtdemokratische Systeme haben viel größere Probleme mit der Nachhaltigkeit. Aber so, wie Demokratien heute organisiert sind, muss man sie institutionell korrigieren.
Welche Defizite bemängeln Sie vor allem?
In der Demokratie wird alle vier, fünf Jahre gewählt. Das führt zu kurzfristigem Denken und dazu, dass die Politiker und Wähler auf sofortige Präferenzerfüllung abonniert sind. Nachhaltigkeit ist aber langfristig angelegt. Auch unser Lobbyismus bewirkt, dass sich das bestorganisierte Interesse durchsetzt, nicht das wichtigste. Und für die zukünftigen Generationen existieren keine starken Fürsprecher.
Nun ist der Konsens ein wesentliches Merkmal der Demokratie und es gibt eine Gegenöffentlichkeit, die auf Nachhaltigkeit drängt. Spiegeln die Ergebnisse nicht die momentanen Interessen in der Gesellschaft wieder?
Sie haben Recht, verschiedene Parteien ringen um Kompromisse und Organisationen wie Greenpeace oder Oxfam versuchen, ein breiteres Feld abzudecken. Aber ihre reale Verhandlungsmacht ist nicht vergleichbar mit der anderer Akteure etwa aus der Wirtschaft, da sie meistens keine Arbeitsplatzargumente in der Hand haben.
Dahinter stehen reale Ängste von Menschen, die durch den derzeitigen Wandel – zum Beispiel in der Energiebranche – befürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Darüber wollen Sie hinweggehen?
Nein. Aber die Arbeitsplatzinteressen sind im aktuellen Verhandlungsprozess schon stark vertreten. Jetzt wäre die Frage, ob man ihnen nicht eine Repräsentanz für Zukunftsinteressen an die Seite stellen sollte, die nicht einfach übergangen werden kann. Es geht darum, die Waage in Ausgleich zu bringen.
Deutschland tut schon einiges. Die Energiewende wurde nach Fukushima ad hoc beschlossen, es gibt den Rat für Nachhaltige Entwicklung, die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie, den Parlamentarischen Beirat für Nachhaltige Entwicklung, einen wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderungen. Sie alle nehmen Einfluss auf die Politik. Das reicht Ihnen nicht?
Diese Beiräte haben nur eine symbolische Wirkung. Sie zeigen nach außen zwar, dass man sich um diese Interessen kümmert – im politischen Prozess verfügen sie de facto aber nicht über genügend Macht, um Ideen durchzusetzen. Der Tübinger Politikwissenschaftler Jörg Tremmel spricht in diesem Zusammenhang immer vom „Beiräte-Unwesen“.
Was sollte man stattdessen tun?
Eine Idee ist, Anwälte der Zukunftsinteressen schon jetzt mit einem Stimmrecht auszustatten und ihnen Mitwirkungsmöglichkeiten in den Entscheidungsgremien zu geben. Solch ein Rat sollte sich aus von Nichtregierungsorganisationen und Forschungsinstituten nominierten Kandidaten zusammensetzen und direkt von den Bürgern oder vom Parlament gewählt werden.
Wie mächtig sollte der Rat sein?
Er sollte Informationen sammeln, diese in der Öffentlichkeit kommunizieren und die Möglichkeit haben, Gesetzesinitiativen im Parlament starten zu können. Der Rat hätte ein parlamentarisches Rede- und möglicherweise ein aufschiebendes oder vollständiges Vetorecht. Damit könnte er geplante Gesetze, die Zukunftsinteressen entgegenlaufen, verändern oder verhindern und insbesondere Katastrophen vorbeugen.
In Israel und Ungarn gab es in den vergangenen Jahren eine ähnliche Institution, einen parlamentarischen Sekretär für Zukunftsinteressen mit einer dazugehörigen Behörde. Wie gut hat die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Parlamenten funktioniert?
Sie hat in beiden Ländern gut funktioniert. Insbesondere der ungarische Kommissar konnte an zahlreichen Stellen etwas bewirken. Übrigens ohne, dass er sein Vetorecht einsetzen musste. Allein die Existenz dieses Rechts hat ausgereicht, um die Politik der Parteien so zu beeinflussen, dass sie gleich zustimmungsfähige Gesetze vorgelegt haben. Als die Mehrheitsverhältnisse sich allerdings drastisch änderten – in Ungarn etwa kam das Orbán-Regime an die Macht –, wurden beiden Kommissaren die finanziellen Mittel gekürzt und sie somit entmachtet.
Gibt es auch in anderen Ländern Bewegung?
Eine Initiative versucht gerade, den Posten eines High Commissioners for Future Generations bei der UN einzurichten. Erstaunlicherweise unterstützen Deutschland und die EU diesen Vorschlag, während sie auf nationaler Ebene blockieren. In Wales wurde ein Parlamentarischer Sekretär ins lokale Parlament gewählt.
Könnte mehr direkte Demokratie mehr Nachhaltigkeit bewirken?
Ich bin da skeptisch. Mehrere Studien haben sich mit dem Wahlverhalten der Schweizer auseinandergesetzt, die häufiger direktdemokratische Instrumente nutzen können. Es zeigt sich, dass in der Schweiz ein Homo Oeconomicus regiert, der einen grauen Bart hat. Das heißt: Die älteren Schweizer, die bei Abstimmungen auch durch den Demografiewandel in der Überzahl sind, setzen ihre Interessen überproportional stark durch.
Die Älteren sagen also: nach mir die Sintflut?
So eine spezifische Untersuchung wäre auch mal interessant: ob bei jüngeren Wählern, wenn sie in der Mehrheit wären, längerfristige Interessen eine größere Rolle spielen würden.
Warum wäre das so wichtig?
Weil wir zum Beispiel Klimagase produzieren, die in der Atmosphäre Hunderte von Jahren wirken. Doch kaum jemand ist bereit, sich darüber jenseits der Perspektive der eigenen Kinder Gedanken zu machen.
Überblicken Politiker noch die Folgen von Entscheidungen, die soweit in die Zukunft ragen?
Das ist im Detail nicht möglich. Die Folgen übersteigen unser Anschauungs- und Vorstellungsvermögen. Das wird insbesondere dadurch verstärkt, dass heutige technische Prozesse in Netzwerken funktionieren. Dafür benötigt man ein Denken in Wechselwirkungen und nicht mehr in linearen Ursache-Wirkungsketten. Aber die Interessen zukünftiger Generationen kann man schon erkennen, wenn man die Grundbedürfnisse betrachtet: in 200 Jahren noch wollen Menschen essen, trinken, atmen.
Dürfen wir überhaupt so weit vorgreifen und zukünftigen Generationen eine Klimapolitik vorschreiben?
Demokratie bedeutet ja auch, dass die Menschen später unsere Entscheidungen rückgängig machen können – wenn sie es denn wünschen. Aber dadurch, dass wir nichts tun, geben wir ihnen Zwänge vor. Wir schaffen momentan irreversible Fakten, an denen man in der Zukunft nicht mehr vorbeikommt. Und gerade um den Menschen später mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung und Demokratie zu ermöglichen, müssen wir handeln und die Zukunft offen halten.
Sie halten Zukunftsräte für ein geeignetes Mittel. Aber wie kann man sie etablieren? Politiker müssten im Gegenzug ihre Macht selbst beschränken. Dazu ist kaum einer bereit.
Das ist die Krux der Idee. Es ist aber möglich, aus einer Minderheit heraus eine Mehrheit umzustimmen, das hat zum Beispiel die kritische Aktionärsversammlung PIRC in den USA in den 90er-Jahren gezeigt. Mit nur elf Prozent aller Stimmen auf der Hauptversammlung zwang sie den Ölkonzern Shell, extern geprüfte Umweltberichte einzuführen. Wenn man die besseren Argumente hat und sie mit einer geschickten Medienpolitik kombiniert, kann man eventuell Machthaber in die Defensive bringen.
Sehen Sie Ansätze dazu bei uns in Deutschland?
Nein, aber ich frage mich schon länger, warum man in Baden-Württemberg nicht einen Weg wie in Wales einschlägt: Die grünrote Mehrheit im Landesparlament könnte eine parlamentarische Institution als Pilotversuch aufbauen – und wenn sich das etabliert, entwickelt sie vielleicht Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus.
Es gibt Kritiker, die das für eine „Ökodiktatur“ halten. Wenn man das mal wörtlich nimmt: Wäre eine Diktatur oder ein autoritäres Regime förderlich?
Nein. Diese Systeme sind nicht lernfähig und flexibel genug, um auf Probleme, wie wir sie haben, zu reagieren. Andererseits deckt sich eine Ökodiktatur nicht mit den Mehrheitsinteressen der Bevölkerung. Sie müsste einen derartig starken Repressionsapparat aufbauen, um die Mehrheit zu zwingen, dass sie darum laufend damit beschäftigt wäre, ihre eigene Machtbasis zu sichern. Die institutionellen Ergänzungen zur Demokratie, die ich angesprochen habe, haben meiner Meinung nach auch keine Ähnlichkeiten mit Ökodiktaturen. Es wird häufig kritisiert, dass das ein Einstieg oder eine „Ökodiktatur light“ sei. Das ist nicht der Fall. Diese Institutionen kommen auf demokratisch legitimiertem Weg ins Amt und sind der demokratischen Kontrolle durch „checks and balances“ unterworfen. Und wir haben derzeit einige schlechter legitimierte Organe, die uns mitregieren: EZB, EU-Kommission, Bundesrat.
Wie bewerten Sie die Entwicklung in China? Die Regierung strebt in ihrem aktuellen Fünfjahresplan so deutlich wie nie zuvor eine umweltfreundlichere Gesellschaft an. Strengere Gesetze, Ausbau von Wind- und Solartechnik – bis 2020 sollen Erneuerbare Energien 15 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. China kann, wenn es will, schneller reagieren als westliche Demokratien.
Natürlich können auch nichtdemokratische Regime etwas ökologisch Wertvolles leisten. China halte ich aber nicht für selbstkritisch genug. Es fehlen die notwendigen Feedback-Mechanismen in der Gesellschaft, die dazu führen, dass man aus Fehlern lernen kann. Chinas Pläne sind löblich, aber sie sind – etwa aufgrund der stark verschmutzten Luft – aus konkreten Zwängen heraus entstanden. Das sind Probleme der Gegenwart. Um zukünftige Interessen geht es dabei zunächst nicht.
Der renommierte US-Autor und Journalist Thomas Friedman hat mal gesagt: „Die USA mögen für einen Tag China sein, um alles Notwendige für den grünen Umbau der Gesellschaft regierungsamtlich anordnen zu können. Dann können wir ja wieder zur Demokratie zurückkehren.“
(lacht) Ein spannendes Gedankeninstrument. Das Problem wäre, dass ein Tag nach so einer imaginierten US-Übernahme einer Ökodiktatur die normalen Interessenlagen wieder greifen, und die würden sagen: Revidiert das mal bitte.
Aber das Hadern mit der Demokratie scheint schon groß zu sein.
Ja, insbesondere wenn man das auf Amerika bezieht. Die USA haben ein strukturell noch viel problematischeres System als Europa oder Deutschland. Die Lobby-Interessen und Abhängigkeiten von der Industrie sind viel stärker. Es gibt Stimmen, die sagen, dass die Demokratie nur noch auf dem Papier besteht. De facto ist das schon eine Oligarchie oder irgendwas anderes.
Auch in Europa ist die Demokratie in die Kritik geraten. Das Vertrauen der Bürger schwindet, demokratische Errungenschaften wurden im Zuge von Finanz- und Wirtschaftskrise zurückgefahren, die Zahl der Demokratien weltweit stagniert oder schrumpft. Schlechte Aussichten für mehr Nachhaltigkeit?
Es ist wahr, dass die Demokratie derzeit kein Exportschlager ist. Aber was hilft es? Man kann nur versuchen, als Modell attraktiv zu sein und so auszustrahlen, dass sich diese Zeiten wieder ändern. Gerade mehr Langfristigkeit könnte Demokratie wieder attraktiver machen.
Von Bernward Gesang sind zu diesem Thema unter anderem die Bücher „Klimaethik“ (2011, Suhrkamp) und „Kann Demokratie Nachhaltigkeit?“ (2014, Springer) erschienen.